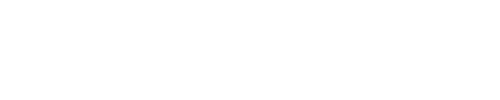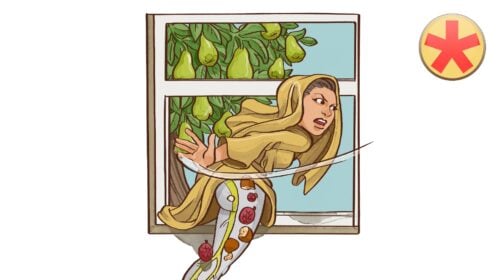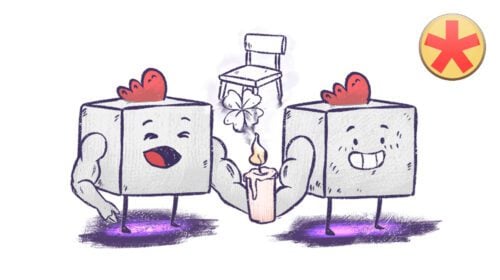Beitrag
Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.
Hier kannst Du einen Zugang erwerben.
Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.
Hast Du bereits einen Zugang?
Melde Dich bitte unter 'Profil' an.
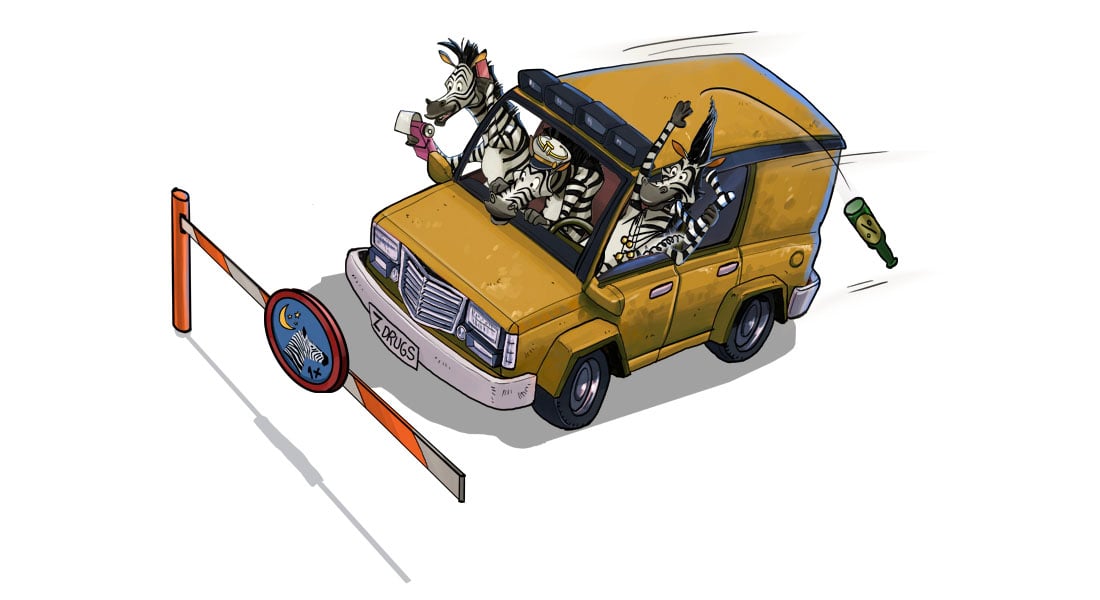
Hier eine Vorschau,
wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Hirnhäute, Epiduralhämatom & Subduralhämatom
Basiswissen
-
Hirnhäute
Drei Hirnhäute: (1) Dura mater
Dürrer Marder ( = harte Mutter)
Das Gehirn und Rückenmark sind von drei Hirnhäuten umgeben. Wir gehen hier von außen nach innen durch.
-
Hirnhäute
Drei Hirnhäute: (2) Arachnoidea
Spinne
Die Arachnoidea - auch: Arachnoidea mater, deutsch: Spinnwebshaut - leitet sich vom griechischen Wort ᾰ̓ρᾰ́χνη (arachne) für „Spinne“ ab.
-
Hirnhäute
Drei Hirnhäute: (3) Pia mater
Pietätsvolle Mutter
-
Hirnhäute > Harte Hirnhaut
Dura mater: außen, mit Schädeldach verwachsen; oben identisch mit Schädel-Knochenhaut
Dürrer Marder: an Decke geklebt, hat Knochen-Haut
Dura mater (auch oft einfach „Dura“ genannt) bedeutet auf Latein „harte Mutter“, auf deutsch wird sie als „harte Hirnhaut“ bezeichnet. Sie ist derb und fest, daher der Name. Die Dura ist fest mit dem Schädeldach verwachsen, deshalb ist sie dort identisch mit der Knochenhaut des Schädeldachs.
-
Hirnhäute > Harte Hirnhaut
Dura mater: Überspringt Furchen des Gehirns außer Interhemisphärenspalt (Falx cerebri)
Dürrer marder interessiert sich nicht für Dreck in Furchen; Falke in großem Spalt
Die Dura mater überspringt die Furchen des Gehirns, abgesehen von der Längsfurche in der Mitte – die Falx cerebri ist das Stück Dura mater, das in den Interhemisphärenspalt ragt.
...
Expertenwissen
-
Blutungen > Epiduralblutung
Epiduralblutung Klinik: Anisokorie
Anis-Chor
Am N. oculomotorius liegen außen die parasympathischen Fasern, u.a. zum M. sphincter pupillae. Kommt es durch Hirndruck zu einer Einengung des N. oculomotorius, werden diese deshalb schon früh beschädigt. Geschieht dies einseitig, ist das besonders einfach zu erkennen: Es kommt zur Anisokorie (Anis-Chor) – also ungleich große Pupillen.
-
Blutungen > Epiduralblutung
Epiduralblutung Therapie: Operative Druckentlastung
Rettungsteam bohrt sich durch die Decke
Die wichtigste Therapie: eine schnelle operative Druckentlastung. Dazu muss der Schädel eröffnet werden, meist durch das Bohren eines Lochs („Bohrlochtrepanation“).
-
Blutungen > Subduralblutung
Subduralblutung Klinik: (1) akuter Verlauf
Akku-Tier
Die Symptome der Subduralblutung können entweder akut oder langsamer und chronisch auftreten, je nach Heftigkeit des zugrundeliegenden Traumas.
...
Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,
werde Teil der Lernrevolution.
Neu
Die 10 neuesten Meditricks:
Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.