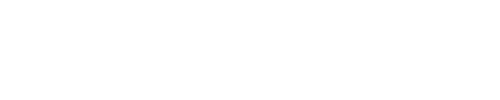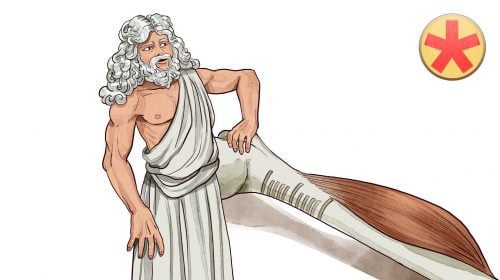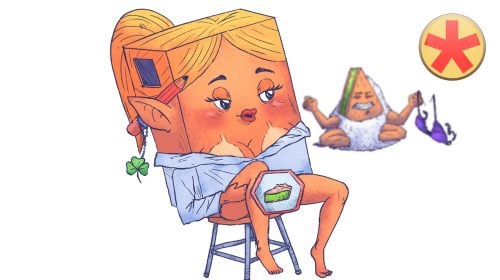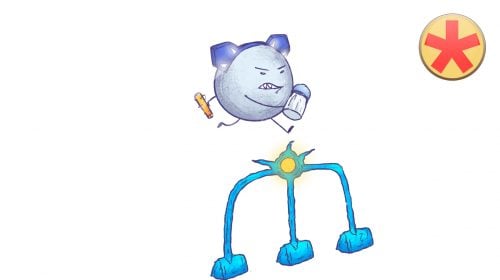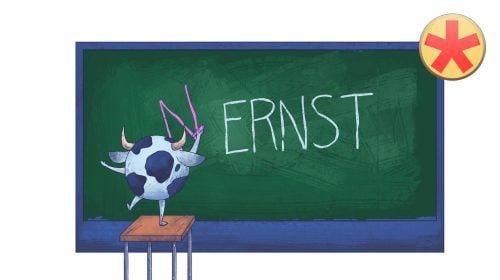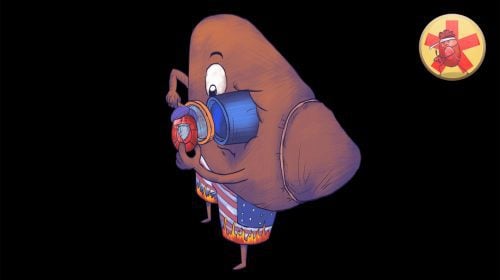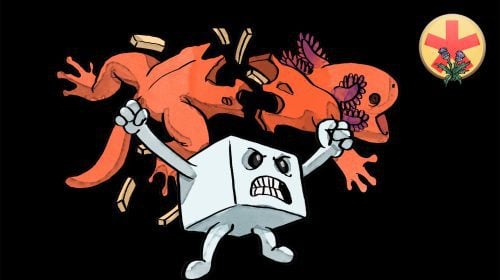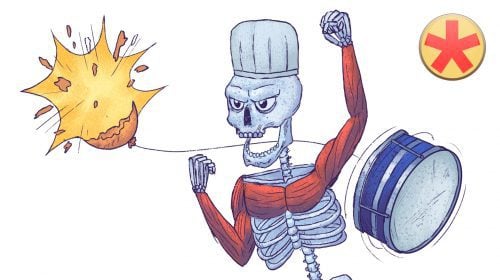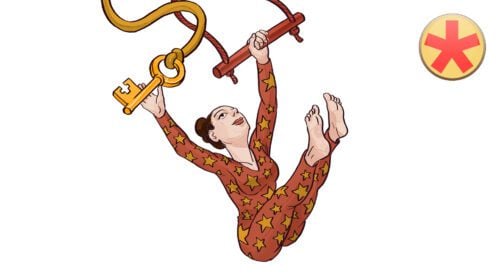Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.
Hier kannst Du einen Zugang erwerben.
Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.
Hast Du bereits einen Zugang?
Melde Dich bitte unter 'Profil' an.
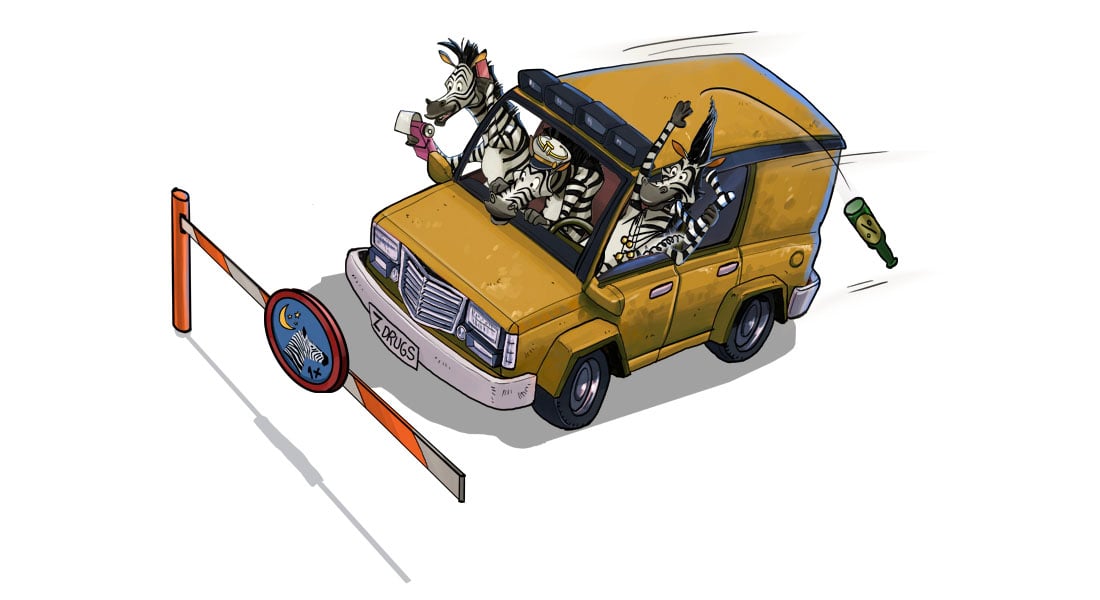
Hier eine Vorschau,
wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Nierentubulus
Basiswissen
-
Allgemeines
Nach Filtration: Nierentubulus → Resorption & Sekretion
Nach Filtration sortieren Tubulusegel Harnkanalisation
Aus den Nieren-Glomeruli (Nierenkörperchen) wird jeden Tag eine riesige Menge an Primärharn (180 Liter) und Nährstoffen filtriert. Der Nierentubulus (“Nierenkanälchen”) muss diese riesigen Mengen reduzieren. Die Niere resorbiert also einen Großteil des Primärharns zurück. Sie muss auch die Nährstoffe resobieren – und zudem Stoffe sezernieren.
-
Allgemeines
4 Abschnitte: proximaler Tubulus, Henle-Schleife, distaler Tubulus, Sammelrohr
4 Bereiche: Rocker Egel, Hennen, triste Egel, Hammel
Man unterscheidet grob vier Bereiche des Nierentubulus. Die verschiedenen Tubulusabschnitte bilden eine hintereinander geschaltetes Röhrensystem, durch das der Primärharn fließt, um prozessiert zu werden. Jeder Abschnitt hat dabei eine bestimmte Aufgabe, die sich auf die weitere Zusammensetzung des Harns auswirkt.
-
Allgemeines
1. Kapillarbett: Filtration
Glomerulum: Harnwasserfall
Eine Besonderheit der Niere ist, dass es zwei Kapillarbette gibt, die u.a. für das Tubulussystem wichtig sind. Das eine Kapillarbett dient zur Filtration.
-
Allgemeines
2. Kapillarbett: Epithel vermittelt zw. Harn & Blut (u.a. Proteine)
Kapillar-Bett: von Egel Gerettete (Steak)
Das zweite Kapillarbett verläuft parallel zum gesamten Nierentubulus, damit die Tubulusepithelzellen Stoffe (u.a. Proteine) zwischen dem Harn im Tubuluslumen und dem Blut austauschen können.
-
Allgemeines
(1/2) Na⁺/ K⁺-ATPase
(1/2) Salz-Bananen-Pumpe
Die Tubulusepithelzellen kleiden das gesamte röhrenförmige Tubulussystem aus. In ihnen befindet sich auf der basolateralen Zellseite die Na⁺/K⁺-ATPase. Als Ionenpumpe transportiert sie unter direktem ATP-Verbrauch (“primär aktiv”) 3 Na⁺-Ionen nach extrazellulär (Richtung Nierenparenchym) und 2 K⁺ Ionen nach intrazellulär (Richtung Tubuluslumen).
...
Expertenwissen
-
Proximaler Tubulus > Frühproximal
Glucoseresorption via SGLT 2 (1 Na⁺, 1 Glucose)
Doppel-Punkrocker rettet Glucken-Zuckerwürfel & Salzstreuer für Ess-Geld
Glucosemoleküle können den glomerulären Filter ungehindert passieren, werden aber im PT vollständig rückresorbiert. Dies geschieht im Natriumsymport über den sog. SGLT-2 Transporter. Der Transport ist sekundär aktiv: Natrium steht für diesen Ko-Transport durch den unter ATP-Verbrauch aufgebauten Natrium-Gradienten der Na⁺/K⁺-ATPase zur Verfügung.
-
Proximaler Tubulus > Frühproximal
Hohe Kapazität, niedrige Affinität
Großes, aber löchriges Netz
Dieser Transporter hat eine niedrige Affinität für Glucose, aber eine hohe Kapazität.
-
Proximaler Tubulus > Spätproximal
Glucoseresorption via SGLT 1 (2Na⁺, 1 Glucose)
Punkrocker mit 1 Iro rettet Glucken-Zuckerwürfel & Salzstreuer für Ess-Geld
Im Verlauf des proximalen Tubulus (v.a. in der Pars recta) fällt die Glucosekonzentration immer weiter ab, sodass eine größere Triebkraft zum Transport nötig ist. 1 Glucosemolekül wird nun im Symport mit 2 Na⁺ über den effektiver arbeitenden SGLT-1 Transporter in die Zellen aufgenommen.
...
Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,
werde Teil der Lernrevolution.
Menü Physiologie
Neu
Die 10 neuesten Meditricks:
Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.