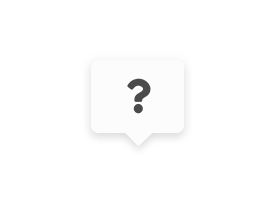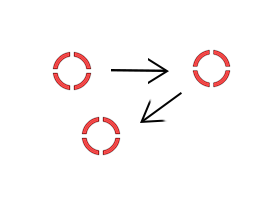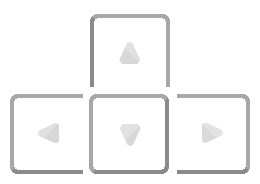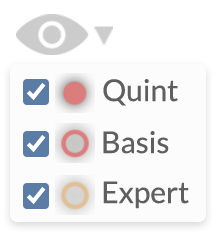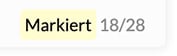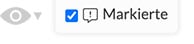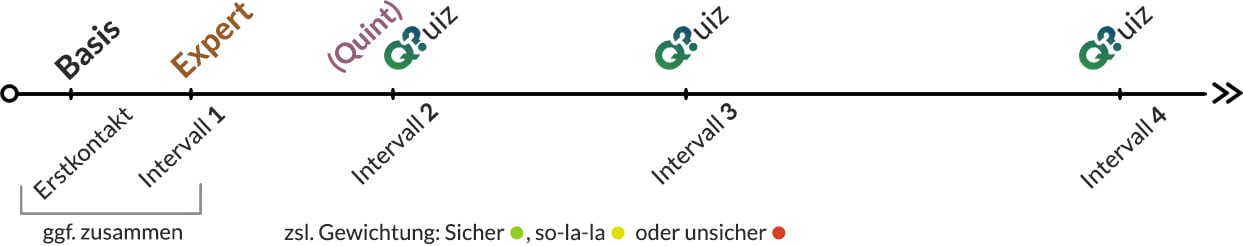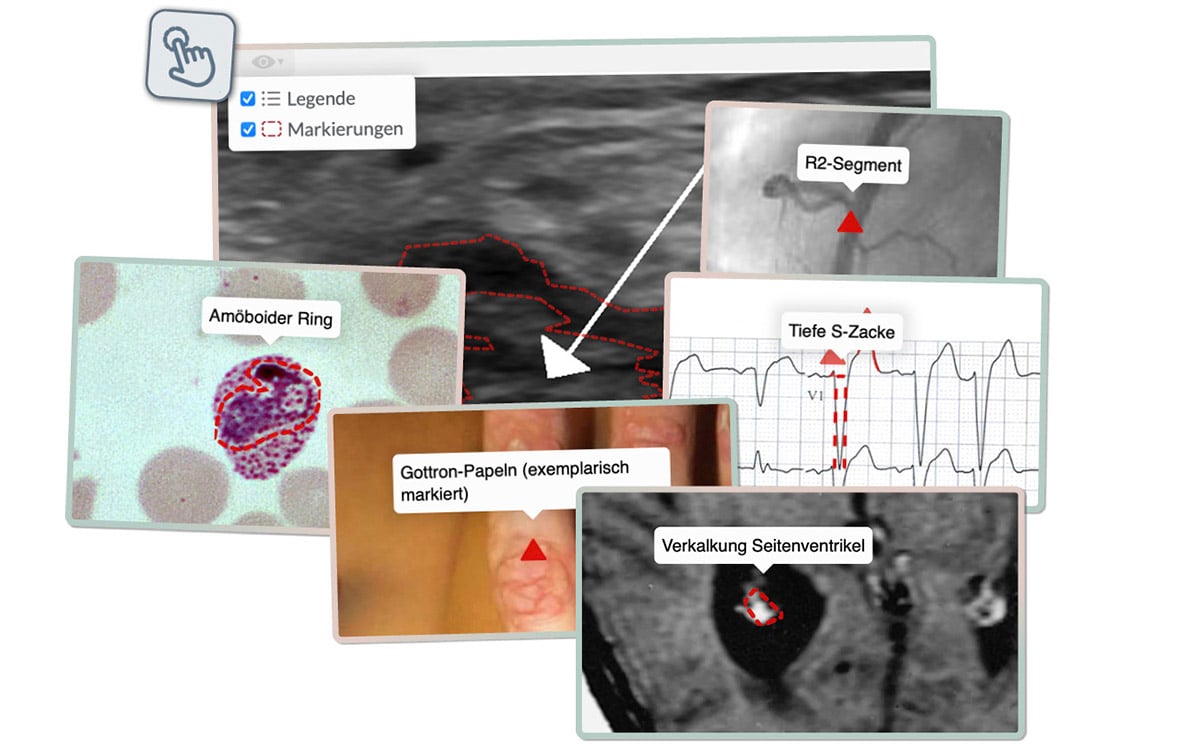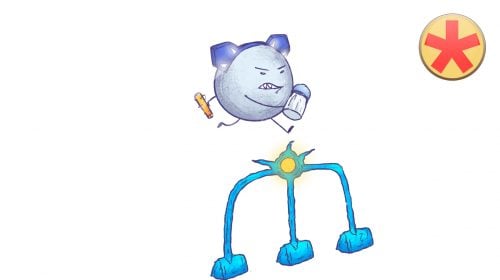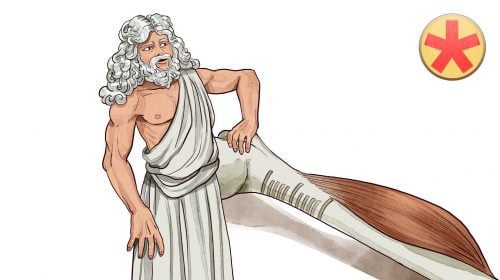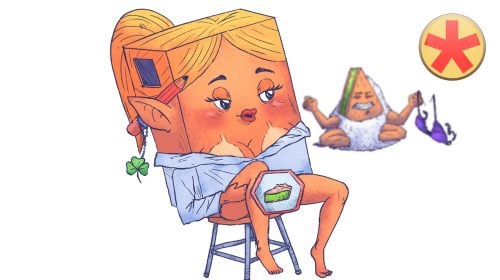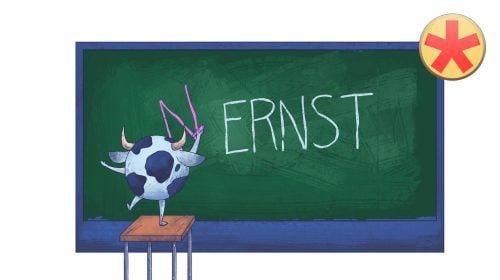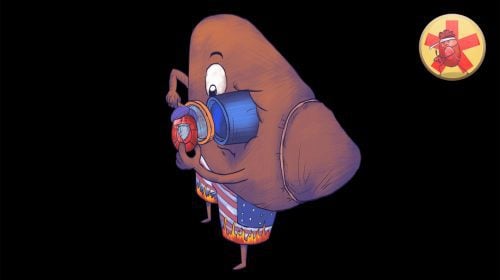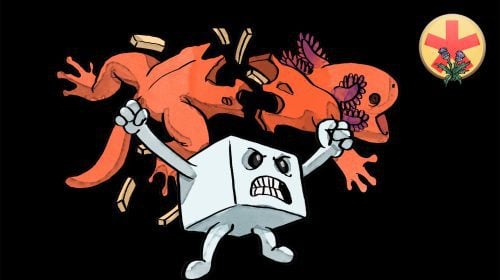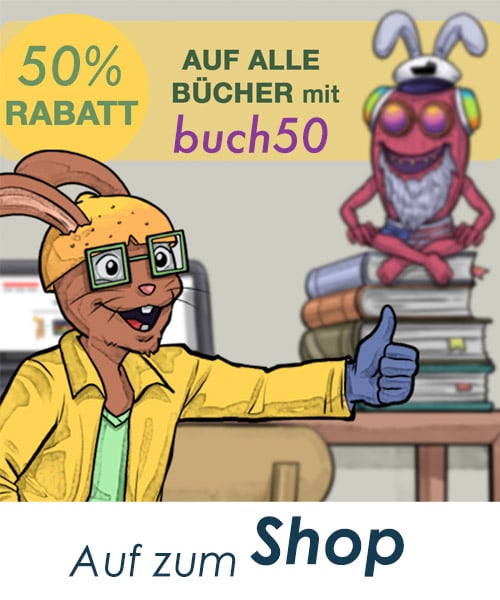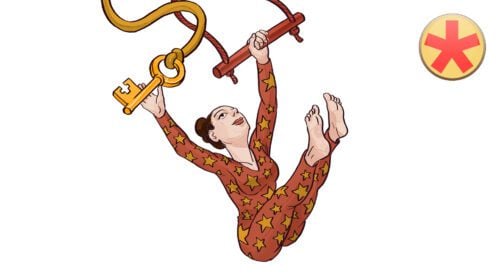Grundlagen
Neuronen-AP: elektrisches Signal durch Ionen-Strom
Neuronenhindernisslauf: elektrischer Staffellauf der Ionenschüler
Das Aktionspotenzial (AP) ist ein elektrisches Signal, mit dem ein Neuron über (Ionen-)Strom Informationen an andere Zellen weiterleiten kann.
1/30
Grundlagen
Signalempfänger: Neurone, Drüsen-, Muskelzellen
Im Ziel sitzen: gelbe, grüne, rote Zelle
2/30
Grundlagen
Intrazellulärraum
Fläche vor Baum & unter blauem Stromkabel
3/30
Grundlagen > RMP
Voraussetzung 1: RMP / polarisierte Membran
Blaues Kabel auf Rennbahn (=RMP) im Polareis
Grundlage für jedes AP ist ein Ruhemembranpotenzial.
4/30
Grundlagen > RMP
Intrazellulär: K+ ↑; Extrazellulär: Na+ ↑
Im Baum: Bananen-Ion; auf Ästen: Salz-Ion
Das RMP entsteht durch die ungleiche Konzentration von Natrium- und Kaliumionen. Im Zellinneren herrscht eine hohe Kaliumkonzentration und eine niedrige Natriumkonzentration. Extrazellulär verhält es sich genau umgekehrt.
5/30
Grundlagen > RMP
RMP ≈ -70 mV
Ruhende Ionen, Zwergenmütze & runder Helm
Die Folge der Ungleichverteilung der Neuronen intra- und extrazellulär ist eine Potenzialdifferenz von -70 mV (Zellinneres ist negativ).
6/30
Grundlagen > RMP
Voraussetzung 2: spannungsgesteuerte Ionenkanäle
Spannungsgesteuerte Tunnel
Damit die Ionen zum richtigen Zeitpunkt die Membran überqueren können, braucht es spannungsgesteuerte Ionenkanäle. Diese messen über einen integrierten Sensor (genauer: S4-Segment) die Membranspannung und öffnen bzw. schließen ihre Kanalpore dementsprechend.
7/30
Grundlagen > RMP
Spannungszeitdiagramm: Zeit (x-Achse) & Spannung (y-Achse)
Rennstrecke: Rennbahn (x-Achse) & Baum (y-Achse)
8/30
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1
Initiationsphase über Dendriten
Startsignal über Äste am Baum
Bei der initialen Depolarisation werden am Dendriten sog. EPSPs und IPSPs (excitatory und inhibitory synaptic potentials) ‒ häufig von anderen Neuronen ‒ ausgelöst. Sie verändern in Summe von außen die Verteilung der Ladungen. Das Innere des Neurons wird durch EPSPs positiver, die Membran wird depolarisiert.
9/30
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1
EPSP: durch Natriumstrom nach intrazellulär
wESPe: mit Salz-Ion in den unteren Bildteil
10/30
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1
Reizschwelle der NaV-Kanäle: - 50 mV
“Schwellen-Sprung” am Hügel: offene Hand, Faust
Um ein AP auszulösen, müssen die EPSPs die sog. Reizschwelle von spannungsgesteuerten NaV-Kanäle am sog. Axonhügel erreichen. Auf ihm liegen die nächsten Ionen-Kanäle. Wird die Reizschwelle von - 50 mV überschritten, öffnen sich die spannungsgesteuerten NaV-Kanäle und lassen weitere Natriumionen in das Neuron einströmen.
11/30
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1
Ablauf nach Alles-oder-Nichts Gesetz
Ein AP dauert beim Neuron ca. 1 ms. Wenn genug Kationen in das Neuron einströmen und genug EPSPs auslösen, wird eine Schwelle erreicht. Weitere Ionenkanäle öffnen und schließen sich in einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge, die das AP auslösen. Falls die Schwelle nicht erreicht wird, kehrt die Zelle zum RMP zurück.
12/30
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1
NaV-Kanäle leiten Phase 2 am Axonhügel ein
Salz-Ion springt zum Salz-Kanal auf Hügel
Ein AP entsteht am spezialisierten Axonhügel des Neurons (nicht am Dendriten) und wird im Axon in Richtung Synapse weitergeleitet. An dieser Stelle kommen besonders viele spannungsgesteuerte Natriumkanäle in der Membran vor, die den Aufstrich des AP auslösen.
13/30
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 2
Aufstrich / Depolarisation → MP positiver
Weißer Blitz schießt hoch → Eis schmilzt (depolarisiert)
Beim Aufstrich nehmen spannungsabhängige Natrium-Ionenkanäle die initiale Depolarisation, also das EPSP wahr. Sie öffnen sich und erlauben einen Natrium-Einstrom in die Zelle. Die Ionen werden nicht aktiv gepumpt, sondern folgen ihrem elektrochemischen Gradienten. Das Membranpotenzial (MP) wird dadurch insgesamt positiver (“Depolarisation”).
14/30
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 2
Overshoot
Blitz schießt über rote Markierung hinaus
Der massive Natrium-Einstrom sorgt dafür, dass das Membranpotenzial sogar positive Werte annimmt. Dieser Zustand heißt Overshoot oder Überschuss.
15/30
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 3
Repolarisation durch Kaliumausstrom
Rückschlag des Blitzes durch Banane – Vereisung
Aufgrund der Depolarisation öffnen sich spannungsabhängige Kaliumkanäle. Durch sie fließen Kalium-Ionen aus dem Zellinneren nach draußen. Auch sie folgen hier ihrem elektrochemischen Gradienten. Das Membranpotenzial wird wieder deutlich negativer. Diesen Vorgang bezeichnet man als Repolarisation.
16/30
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 3
Amplitude: Maximale Auslenkung
Blitz am maximalen Punkt
Die Amplitude bezeichnet die maximale Auslenkung des APs.
17/30
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 4
Hyperpolarisation ‒ unter RMP
Eisblitz ‒ geht unter blaues Kabel
Durch die Kaliumkanäle strömt Kalium so lange aus der Zelle, bis das Membranpotenzial sogar unter das RMP fällt. Dies wird auch Hyperpolarisation genannt.
18/30
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 4
(Absolute) Refraktärzeit
Kanal wird blockiert
Nach dem AP sind zuerst alle Natriumkanäle refraktär, d.h. sie können nicht aktiviert werden. Ein weiteres AP kann jetzt nicht ausgelöst werden, denn die Ausbreitung des APs soll nur in Richtung Synapse erfolgen.
19/30
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 4
Relative Refraktärzeit → niedrigeres AP
Halb geschlossener Salz-Kanal → kleinerer Blitz
Noch bevor die komplette Neuronenmembran den erregbaren Ruhezustand erreicht, können die ersten Natrium-Kanäle wieder aktiviert werden. Da sie aber nur ein kleiner Teil der Gesamtheit sind, liegt die Reizschwelle in der relativen Refraktärzeit höher und die Amplitude, der Ausschlag des resultierenden APs, ist kleiner.
20/30
Weiterleitung von Aktionspotentialen
Kontinuierliche Erregungsleitung
Rennstrecke ohne Hürden
Es gibt 2 Arten der Reiz-Weiterleitung: kontinuierlich und saltatorisch. Die kontinuierliche Weiterleitung ist langsamer. Ein AP, das am Axonhügel entsteht, sorgt in seiner Umgebung für eine Veränderung der Ionenverteilung (Depolarisation). Als Folge öffnen in der benachbarten Axonmembran weitere spannungsabhängige Natriumkanäle. Der Reiz wird so über die gesamte Axon-Länge in Richtung Synapse fortgeleitet.
21/30
Weiterleitung von Aktionspotentialen
Saltatorische Erregungsleitung
Hürdenlauf
Bei der saltatorischen (springenden) Erregungsleitung isolieren myelinisierte Axone Teile des Axons. Die Ladungsverschiebung beeinflusst so einen NaV-Kanal, der nicht dicht benachbart ist, sondern weiter weg. Die elektrische Leitung überspringt Teile des Axons einfach und spart dadurch Zeit. So werden höhere Leitungsgeschwindigkeiten erreicht.
22/30
Weiterleitung von Aktionspotentialen > Myelinisierung
Gliazellen
Gliazell-Hürden
Stützzellen (auch Gliazellen genannt) bilden die bereits erwähnte Myelinisierung. Die Gliazellen sind um die Axone gewickelt und isolieren diese. Im Bereich der Gliazellen ist dann so gut wie kein Ionenfluss durch die Membran möglich.
23/30
Weiterleitung von Aktionspotentialen > Myelinisierung
Ranvier-Schnürringe
Schnur-Ring um Tunnel
Die Bereiche zwischen den Gliazellen heißen Ranvier-Schnürringe.
24/30
Weiterleitung von Aktionspotentialen > Definitionen
Frequenzkodierung
Radio mit verschiedenen Frequenzen
Ein einzelnes AP läuft stereotyp ab. Zeitdauer und Amplitude sind durch Refraktärphasen und Kanaleigenschaften streng vorgegeben. Um trotzdem unterschiedliche Informationen über das Axon zu versenden, wird die Frequenz moduliert, d.h. unterschiedlich viele APs pro Sekunde. So werden unterschiedliche Zustände übermittelt.
25/30
Weiterleitung von Aktionspotentialen > Definitionen
Rheobase: minimale Stromstärke
Reh-Bass: Bass funktioniert nur mit genug Strom
Nervenfasern kommen in vielen verschiedenen Formen vor. Die Rheobase beschreibt die minimale Reiz-/Stromstärke, die man zur Auslösung eines APs benötigt. Durch unterschiedliche Myelinisierung und variable Ausstattung mit Kanälen unterscheiden sich die physikalischen Eigenschaften des “Axon-Kabels” ganz erheblich.
26/30
Weiterleitung von Aktionspotentialen > Definitionen
Chronaxie
Stoppuhr mit Axt und Blitz
Ein zweiter Kennwert für Nervenfasern ist die Chronaxie: Hier ermittelt man, wie lange man den Nerv mit einer bestimmten Stromstärke reizen muss, bis es zur AP-Auslösung kommt. Die Reizstärke wählt man hierbei doppelt so groß wie die Rheobase.
27/30
Kanalphysiologie
NaV-Kanal: 1x4
Je ein Salz-Kanal mit vier Antennen
Ionen können die Zellmembran von Neuronen nur mit Hilfe überqueren. Hier fließen die Ionen durch spannungsgesteuerte Natrium- bzw. Kaliumkanäle. Im Aufbau unterscheiden sich die beiden Kanäle: der Natriumkanal besteht aus einem Protein, dessen 4 Anteile gemeinsam eine Pore bilden.
28/30
Kanalphysiologie
KV-Kanal: 4x1
Vier gelbe Kanäle bilden einen Kanal
Beim Kaliumkanal sieht der Aufbau anders aus: Hier lagern sich vier separate Proteine zu einer Pore zusammen.
29/30
Kanalphysiologie
NaV-Kanäle: Ball-and-Chain Mechanismus
Eisball an Salz-Kanal gekettet
Die Natrium-Kanäle benutzen zum Umschalten zwischen "offen" und "geschlossen" eine besondere Technik: Eine Membrandomäne blockiert die Kanalpore, sodass sie von einem Moment auf den anderen geschlossen (inaktiviert) wird, auch Ball-and-Chain Mechanismus genannt. Folge ist die Refraktärzeit.
30/30
fAsdnn34#SD6%4mgLS9(#k-mn
https://www.meditricks.de/wp-content/plugins/meditricks-mt-quiz/include/
n
68765
Was ist Ankizin?
Ankizin ist ein Projekt der AG Medizinische-Ausbildung bvmd e.V.
Es ist das größte non-profit, studentisch organisierte Anki-Projekt im deutschsprachigen Raum.
Ziel ist die Umsetzung des gesamten notwendigen Wissens für alle medizinischen Staatsexamina.
In freundlicher Kooperation bieten wir im Ankizin-Deck passgenau unsere Merkhilfen in den jeweiligen Anki-Karten an. Die so verknüpften Fragen kannst Du mit freundlicher Genehmigung der bvmd auch hier als Quiz ansehen.
Du findest alle Inhalte auch im Ankizin-Deck in Anki.
Es ist das größte non-profit, studentisch organisierte Anki-Projekt im deutschsprachigen Raum.
Ziel ist die Umsetzung des gesamten notwendigen Wissens für alle medizinischen Staatsexamina.
In freundlicher Kooperation bieten wir im Ankizin-Deck passgenau unsere Merkhilfen in den jeweiligen Anki-Karten an. Die so verknüpften Fragen kannst Du mit freundlicher Genehmigung der bvmd auch hier als Quiz ansehen.
Du findest alle Inhalte auch im Ankizin-Deck in Anki.
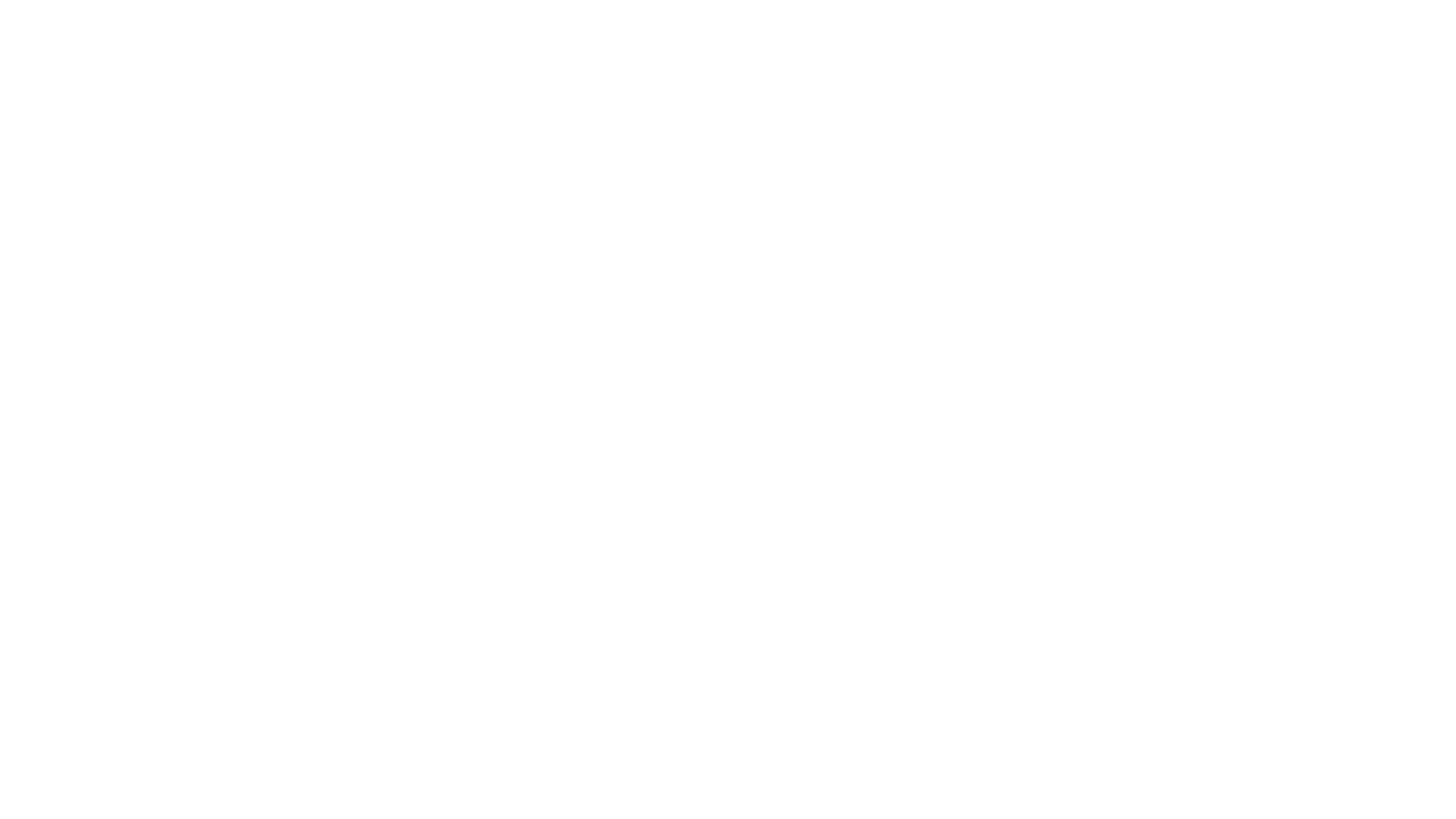
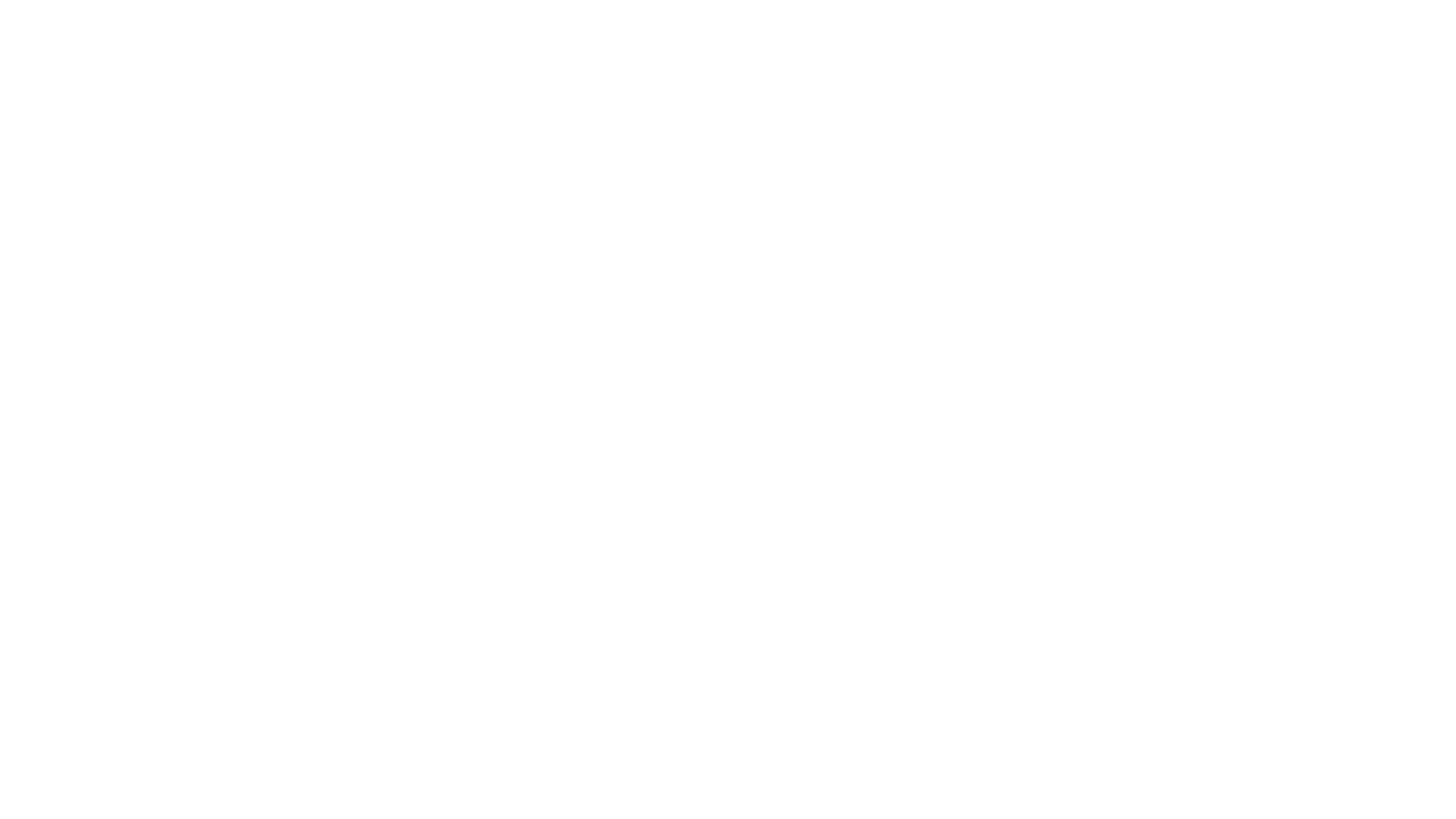
1
Grundlagen
Neuronenhindernisslauf: elektrischer Staffellauf der Ionenschüler
Das Aktionspotenzial (AP) ist ein elektrisches Signal, mit dem ein Neuron über (Ionen-)Strom Informationen an andere Zellen weiterleiten kann.
alles
anzeigen
2
Grundlagen
Im Ziel sitzen: gelbe, grüne, rote Zelle
3
4
Grundlagen > RMP
Blaues Kabel auf Rennbahn (=RMP) im Polareis
Grundlage für jedes AP ist ein Ruhemembranpotenzial.
alles
anzeigen
5
Grundlagen > RMP
Im Baum: Bananen-Ion; auf Ästen: Salz-Ion
Das RMP entsteht durch die ungleiche Konzentration von Natrium- und Kaliumionen. Im Zellinneren herrscht eine hohe Kaliumkonzentration und eine niedrige Natriumkonzentration. Extrazellulär verhält es sich genau umgekehrt.
alles
anzeigen
6
Grundlagen > RMP
Ruhende Ionen, Zwergenmütze & runder Helm
Die Folge der Ungleichverteilung der Neuronen intra- und extrazellulär ist eine Potenzialdifferenz von -70 mV (Zellinneres ist negativ).
alles
anzeigen
7
Grundlagen > RMP
Spannungsgesteuerte Tunnel
Damit die Ionen zum richtigen Zeitpunkt die Membran überqueren können, braucht es spannungsgesteuerte Ionenkanäle. Diese messen über einen integrierten Sensor (genauer: S4-Segment) die Membranspannung und öffnen bzw. schließen ihre Kanalpore dementsprechend.
alles
anzeigen
8
Grundlagen > RMP
Rennstrecke: Rennbahn (x-Achse) & Baum (y-Achse)
9
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1
Startsignal über Äste am Baum
Bei der initialen Depolarisation werden am Dendriten sog. EPSPs und IPSPs (excitatory und inhibitory synaptic potentials) ‒ häufig von anderen Neuronen ‒ ausgelöst. Sie verändern in Summe von außen die Verteilung der Ladungen. Das Innere des Neurons wird durch EPSPs positiver, die Membran wird depolarisiert.
alles
anzeigen
10
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1
wESPe: mit Salz-Ion in den unteren Bildteil
11
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1
“Schwellen-Sprung” am Hügel: offene Hand, Faust
Um ein AP auszulösen, müssen die EPSPs die sog. Reizschwelle von spannungsgesteuerten NaV-Kanäle am sog. Axonhügel erreichen. Auf ihm liegen die nächsten Ionen-Kanäle. Wird die Reizschwelle von - 50 mV überschritten, öffnen sich die spannungsgesteuerten NaV-Kanäle und lassen weitere Natriumionen in das Neuron einströmen.
alles
anzeigen
12
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1
Ein AP dauert beim Neuron ca. 1 ms. Wenn genug Kationen in das Neuron einströmen und genug EPSPs auslösen, wird eine Schwelle erreicht. Weitere Ionenkanäle öffnen und schließen sich in einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge, die das AP auslösen. Falls die Schwelle nicht erreicht wird, kehrt die Zelle zum RMP zurück.
alles
anzeigen
13
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 1
Salz-Ion springt zum Salz-Kanal auf Hügel
Ein AP entsteht am spezialisierten Axonhügel des Neurons (nicht am Dendriten) und wird im Axon in Richtung Synapse weitergeleitet. An dieser Stelle kommen besonders viele spannungsgesteuerte Natriumkanäle in der Membran vor, die den Aufstrich des AP auslösen.
alles
anzeigen
14
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 2
Weißer Blitz schießt hoch → Eis schmilzt (depolarisiert)
Beim Aufstrich nehmen spannungsabhängige Natrium-Ionenkanäle die initiale Depolarisation, also das EPSP wahr. Sie öffnen sich und erlauben einen Natrium-Einstrom in die Zelle. Die Ionen werden nicht aktiv gepumpt, sondern folgen ihrem elektrochemischen Gradienten. Das Membranpotenzial (MP) wird dadurch insgesamt positiver (“Depolarisation”).
alles
anzeigen
15
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 2
Blitz schießt über rote Markierung hinaus
Der massive Natrium-Einstrom sorgt dafür, dass das Membranpotenzial sogar positive Werte annimmt. Dieser Zustand heißt Overshoot oder Überschuss.
alles
anzeigen
16
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 3
Rückschlag des Blitzes durch Banane – Vereisung
Aufgrund der Depolarisation öffnen sich spannungsabhängige Kaliumkanäle. Durch sie fließen Kalium-Ionen aus dem Zellinneren nach draußen. Auch sie folgen hier ihrem elektrochemischen Gradienten. Das Membranpotenzial wird wieder deutlich negativer. Diesen Vorgang bezeichnet man als Repolarisation.
alles
anzeigen
17
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 3
Blitz am maximalen Punkt
Die Amplitude bezeichnet die maximale Auslenkung des APs.
alles
anzeigen
18
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 4
Eisblitz ‒ geht unter blaues Kabel
Durch die Kaliumkanäle strömt Kalium so lange aus der Zelle, bis das Membranpotenzial sogar unter das RMP fällt. Dies wird auch Hyperpolarisation genannt.
alles
anzeigen
19
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 4
Kanal wird blockiert
Nach dem AP sind zuerst alle Natriumkanäle refraktär, d.h. sie können nicht aktiviert werden. Ein weiteres AP kann jetzt nicht ausgelöst werden, denn die Ausbreitung des APs soll nur in Richtung Synapse erfolgen.
alles
anzeigen
20
Ablauf eines Aktionspotentials > Phase 4
Halb geschlossener Salz-Kanal → kleinerer Blitz
Noch bevor die komplette Neuronenmembran den erregbaren Ruhezustand erreicht, können die ersten Natrium-Kanäle wieder aktiviert werden. Da sie aber nur ein kleiner Teil der Gesamtheit sind, liegt die Reizschwelle in der relativen Refraktärzeit höher und die Amplitude, der Ausschlag des resultierenden APs, ist kleiner.
alles
anzeigen
21
Weiterleitung von Aktionspotentialen
Rennstrecke ohne Hürden
Es gibt 2 Arten der Reiz-Weiterleitung: kontinuierlich und saltatorisch. Die kontinuierliche Weiterleitung ist langsamer. Ein AP, das am Axonhügel entsteht, sorgt in seiner Umgebung für eine Veränderung der Ionenverteilung (Depolarisation). Als Folge öffnen in der benachbarten Axonmembran weitere spannungsabhängige Natriumkanäle. Der Reiz wird so über die gesamte Axon-Länge in Richtung Synapse fortgeleitet.
alles
anzeigen
22
Weiterleitung von Aktionspotentialen
Hürdenlauf
Bei der saltatorischen (springenden) Erregungsleitung isolieren myelinisierte Axone Teile des Axons. Die Ladungsverschiebung beeinflusst so einen NaV-Kanal, der nicht dicht benachbart ist, sondern weiter weg. Die elektrische Leitung überspringt Teile des Axons einfach und spart dadurch Zeit. So werden höhere Leitungsgeschwindigkeiten erreicht.
alles
anzeigen
23
Weiterleitung von Aktionspotentialen > Myelinisierung
Gliazell-Hürden
Stützzellen (auch Gliazellen genannt) bilden die bereits erwähnte Myelinisierung. Die Gliazellen sind um die Axone gewickelt und isolieren diese. Im Bereich der Gliazellen ist dann so gut wie kein Ionenfluss durch die Membran möglich.
alles
anzeigen
24
Weiterleitung von Aktionspotentialen > Myelinisierung
Schnur-Ring um Tunnel
Die Bereiche zwischen den Gliazellen heißen Ranvier-Schnürringe.
alles
anzeigen
25
Weiterleitung von Aktionspotentialen > Definitionen
Radio mit verschiedenen Frequenzen
Ein einzelnes AP läuft stereotyp ab. Zeitdauer und Amplitude sind durch Refraktärphasen und Kanaleigenschaften streng vorgegeben. Um trotzdem unterschiedliche Informationen über das Axon zu versenden, wird die Frequenz moduliert, d.h. unterschiedlich viele APs pro Sekunde. So werden unterschiedliche Zustände übermittelt.
alles
anzeigen
26
Weiterleitung von Aktionspotentialen > Definitionen
Reh-Bass: Bass funktioniert nur mit genug Strom
Nervenfasern kommen in vielen verschiedenen Formen vor. Die Rheobase beschreibt die minimale Reiz-/Stromstärke, die man zur Auslösung eines APs benötigt. Durch unterschiedliche Myelinisierung und variable Ausstattung mit Kanälen unterscheiden sich die physikalischen Eigenschaften des “Axon-Kabels” ganz erheblich.
alles
anzeigen
27
Weiterleitung von Aktionspotentialen > Definitionen
Stoppuhr mit Axt und Blitz
Ein zweiter Kennwert für Nervenfasern ist die Chronaxie: Hier ermittelt man, wie lange man den Nerv mit einer bestimmten Stromstärke reizen muss, bis es zur AP-Auslösung kommt. Die Reizstärke wählt man hierbei doppelt so groß wie die Rheobase.
alles
anzeigen
28
Kanalphysiologie
Je ein Salz-Kanal mit vier Antennen
Ionen können die Zellmembran von Neuronen nur mit Hilfe überqueren. Hier fließen die Ionen durch spannungsgesteuerte Natrium- bzw. Kaliumkanäle. Im Aufbau unterscheiden sich die beiden Kanäle: der Natriumkanal besteht aus einem Protein, dessen 4 Anteile gemeinsam eine Pore bilden.
alles
anzeigen
29
Kanalphysiologie
Vier gelbe Kanäle bilden einen Kanal
Beim Kaliumkanal sieht der Aufbau anders aus: Hier lagern sich vier separate Proteine zu einer Pore zusammen.
alles
anzeigen
30
Kanalphysiologie
Eisball an Salz-Kanal gekettet
Die Natrium-Kanäle benutzen zum Umschalten zwischen "offen" und "geschlossen" eine besondere Technik: Eine Membrandomäne blockiert die Kanalpore, sodass sie von einem Moment auf den anderen geschlossen (inaktiviert) wird, auch Ball-and-Chain Mechanismus genannt. Folge ist die Refraktärzeit.
alles
anzeigen
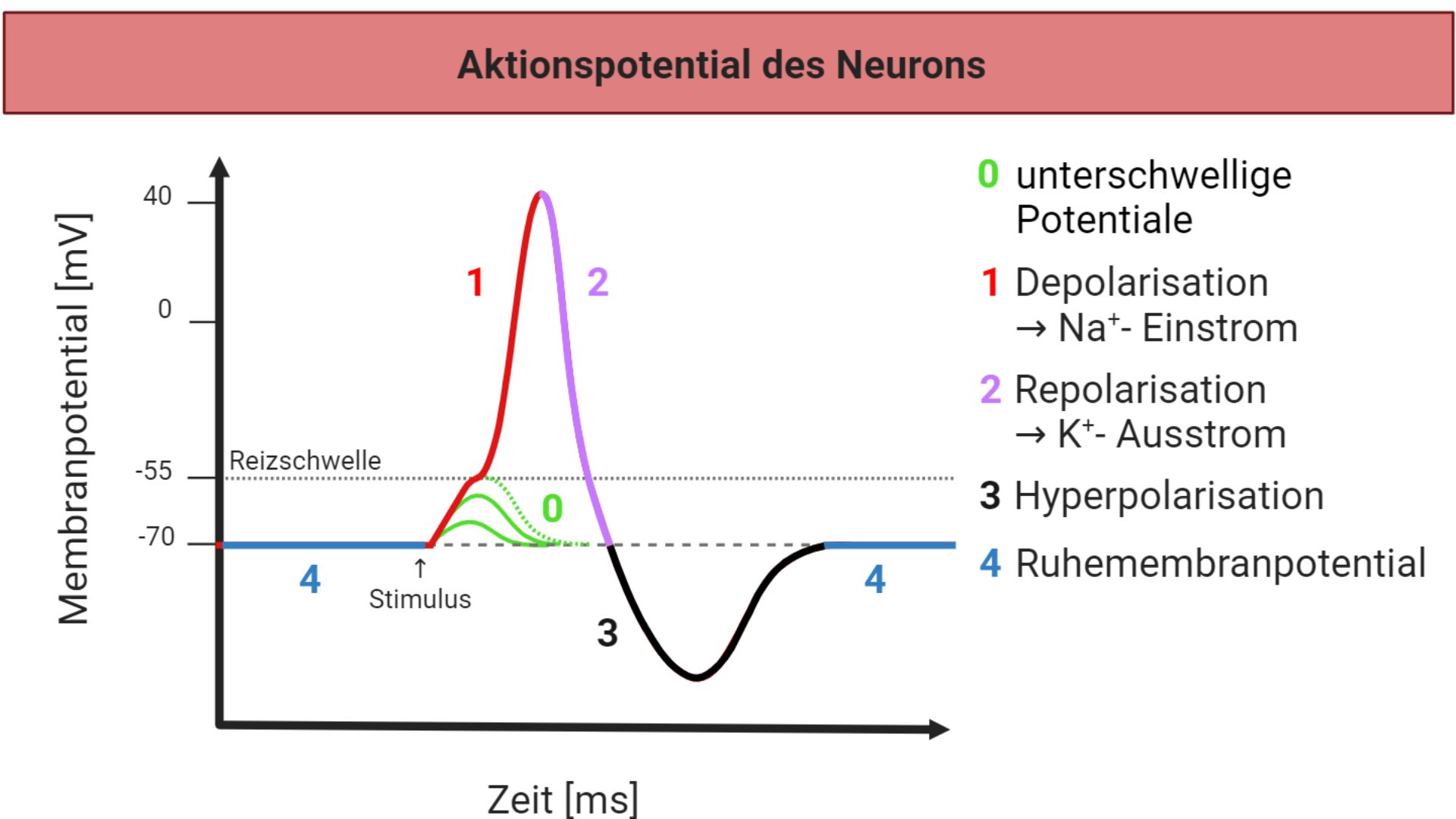
Aktionspotential Neuron Diagramm -
Meditricks Schaubild, erstellt mit BioRender.com
© Meditricks GmbH
Meine Notizen
|
Menü Physiologie
Rückmeldung
Unsere Meditricks wurden mit viel Liebe ersonnen, illustriert und vertont. Gib uns gerne Lob, Kritik über die Feedback-Funktion unter den Meditricks oder schreib uns – siehe Kontakt.
Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.
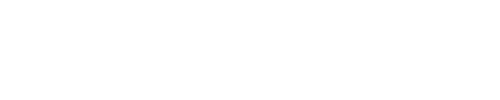
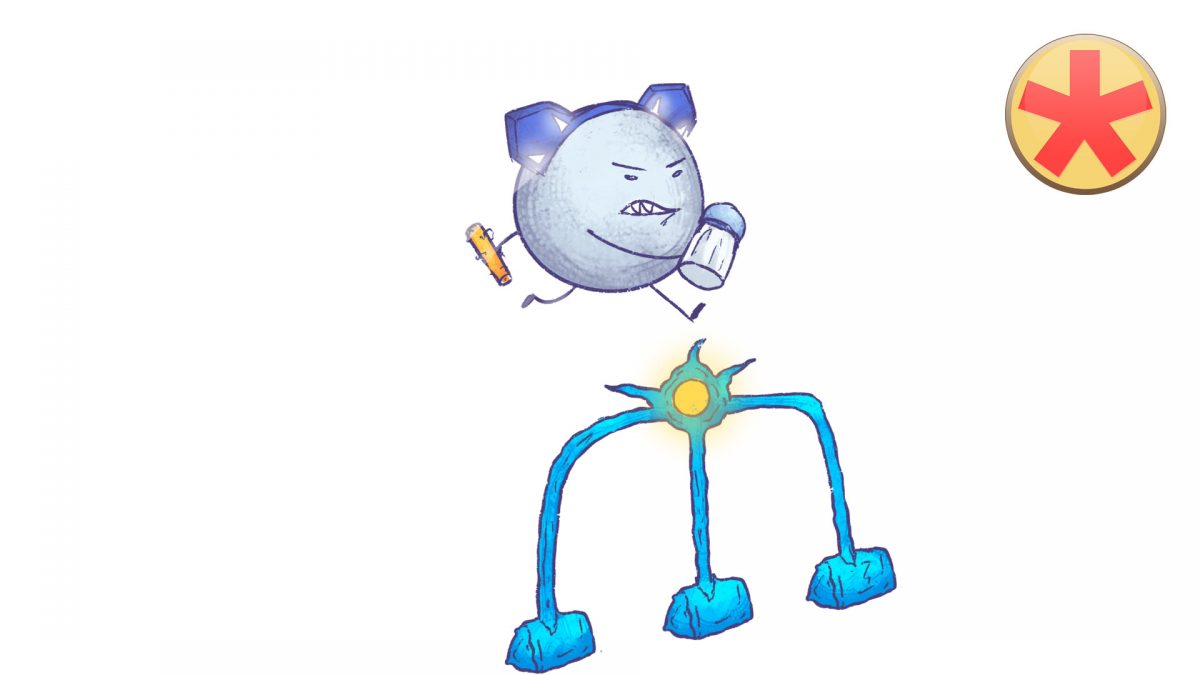

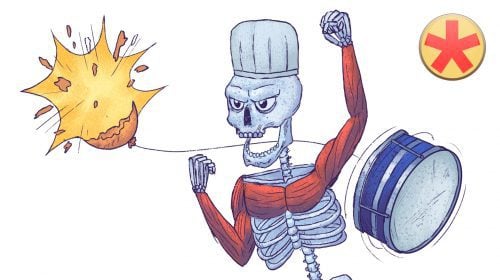


 Quint
Quint