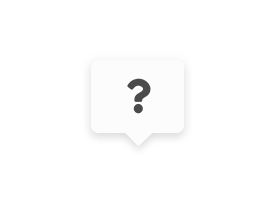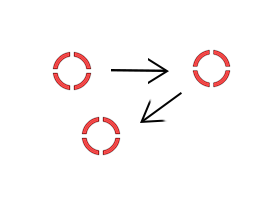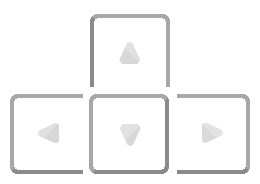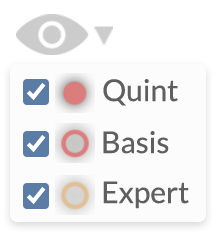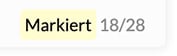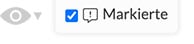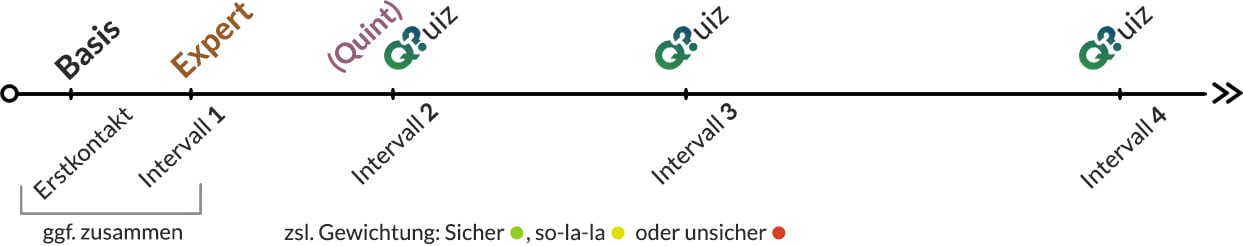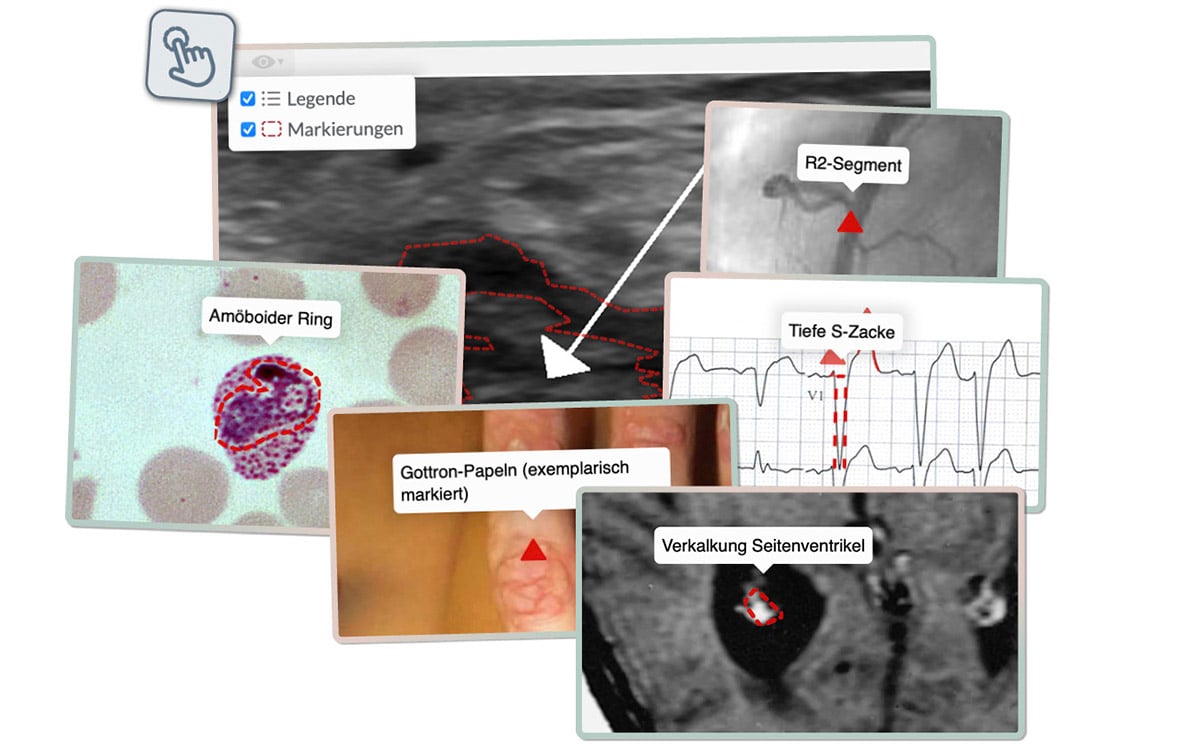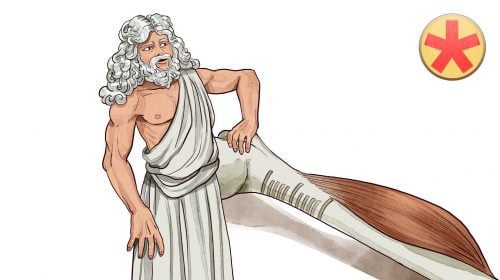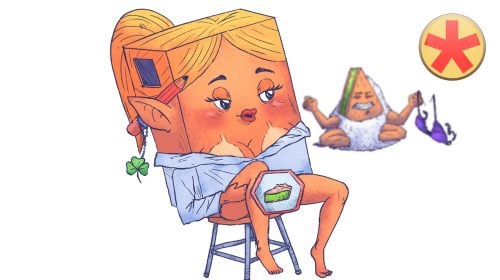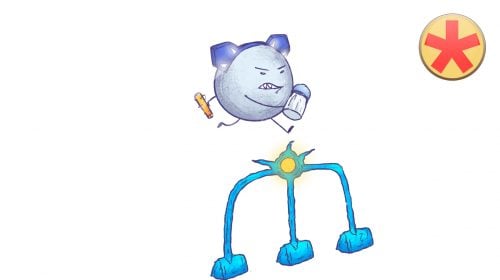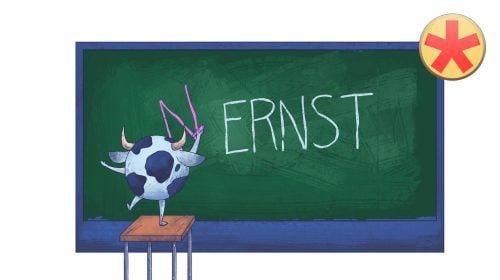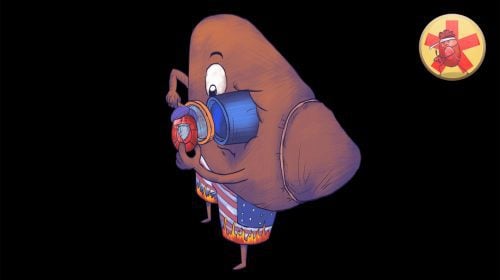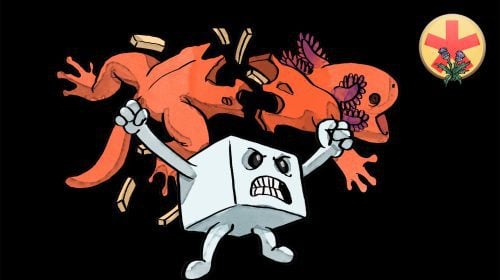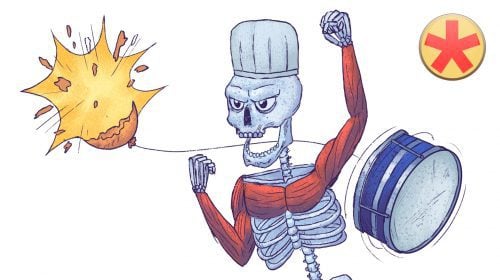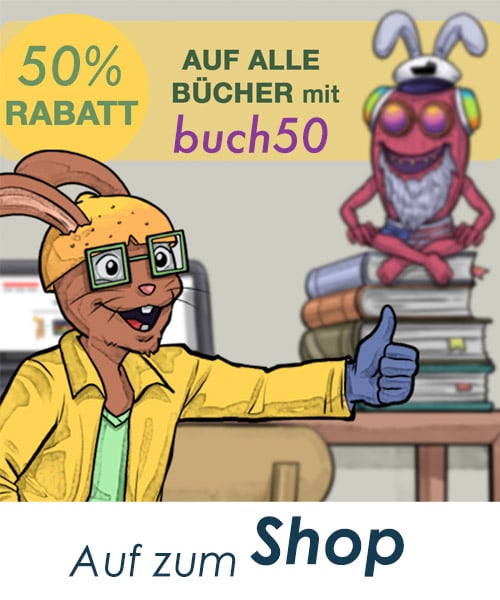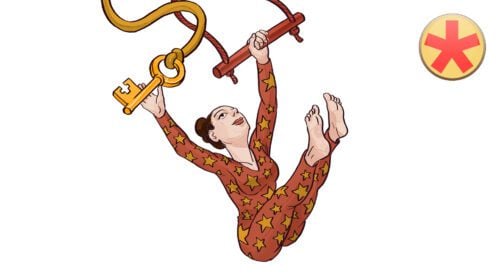Grundlagen
Hebel (z.B. Knochen) verringern Kraftaufwand
Über Knochenhebel kann Welt bewegt werden
Hebel sind starre meist längliche Körper, mit deren Hilfe man Massen mit weniger Kraft halten oder bewegen kann. Dieses Verhältnis ist proportional: Je länger der Hebel, desto weniger Kraft braucht es. Der menschliche Bewegungsapparat benutzt Knochen als Hebel. Knochen sparen also u.a. unseren Muskeln Kraft, um Objekte zu bewegen.
1/30
Grundlagen
Last mit Gewichtskraft (FG) in Newton
Erde im Knast ('Last') mit Newton-Perücke
Grundlagen der Gewichtskraft: Alle Massen üben durch die Schwerkraft bedingt eine gewisse Kraft auf ihre Unterlage oder ihre Aufhängung aus. Diese Kraft wird Gewichtskraft (FG) genannt und in Newton angegeben. Jede Masse übt also eine Last mit der Gewichtskraft FG aus. Um diese Last zu bewegen, muss die Gewichtskraft überwunden werden.
2/30
Grundlagen
Masse (m) in Kilo
Asse mit Kilo
Die Masse mit dem Formelzeichen m wird in Kilogramm angegeben. Die Masse ist nur ein Teil der Gewichtskraft, der jedoch überall im Universum gleich ist. Die Masse eines Autos ist auf der Erde und auf dem Mond gleich.
3/30
Grundlagen
Erdbeschleunigung g
g-Apfel der Erde
Die Beschleunigung g (engl. gravitation) resultiert aus der Schwerkraft, welche die Masse anzieht.
4/30
Grundlagen
Erdbeschleunigung g = 9,81 m/s²
G-Apfel auf Fahne in Form einer 9, Sanduhr, Kerze
Die Beschleunigung ist im Unterschied zur Masse abhängig vom Planeten und seiner Schwerkraft. Die Beschleunigung auf der Sonne ist zum Beispiel 28 Mal höher als auf der Erde.
5/30
Grundlagen
Gewichtskraft = Masse * Beschleunigung (Fg = m * g)
Asse (m), Erde (stellt das Malzeichen dar), Gravitationsapfel (g)
Die Gewichtskraft ist die Masse (m) des Objektes mal der Beschleunigung. Während die Masse überall im Universum gleich ist, ändert sich die Beschleunigung je nach Schwerkraft des Planeten.
6/30
Hebelaufbau
Hebelarm
Humerus-Hebel
Der Hebelarm ist der gesamte starre Körper. Er kann weiter in Kraft- und Lastarm unterteilt werden, je nachdem wo am Hebel die Kraft und wo die Last in Bezug auf den Drehpunkt einwirkt.
7/30
Hebelaufbau
Dreh- bzw. Angelpunkt: Gelenk
Dreh-Rolle und Angel mit Gelenk
Ein Hebelsystem hat einen Dreh- bzw. Angelpunkt. In unserem Bewegungsapparat sind die Gelenke Dreh- und Angelpunkte der Hebel. Um diese Achse des Hebels herum werden Last und Kraft “aufeinander übertragen”.
8/30
Hebelaufbau
Kraftarm [m]: Seite, auf der (Muskel-)Kraft aufgebracht wird
Muskel [Meterstab-Markierung]: Teil zw. Archimedes und Drehpunkt
Auf dem Hebelarm ist dies der Abstand zwischen dem Drehpunkt (Gelenk, z.B. das Ellbogengelenk) und dem Punkt, wo die Muskelkraft angreift (Muskelinsertionspunkt, z.B. der Bizepssehne). Je größer der Kraftarm, desto mehr reduziert der Hebelarm die nötige Kraft. Einheit sind Meter.
9/30
Hebelaufbau
Kraft in Newton: Muskelkraft
Archimedes trägt für Kraftakt Newtonperücke
Die Kraft wird in unserem Bewegungsapparat von Muskeln aufgebracht und in Newton gemessen.
10/30
Hebelaufbau
Lastarm: hier liegt Last
Knast um Ende des Knochens: darauf Erde
Der Lastarm ist die Seite des Hebels, auf der die Last liegt: der Abstand des Punktes, an dem die Last angreift, von der Drehachse. Je größer der Lastarm, desto größer ist die Kraft, die nötig ist, um die Last darauf zu bewegen. Last wird in Newton angegeben.
11/30
Hebelklassen
Hebelsysteme im Bewegungsapparat: Knochen & Muskeln
Mit drei umnebelten Hebelbeispielen: Muskel-Skelett
Alle Komponenten eines Hebels werden als Hebelsystem bezeichnet. In unserem Bewegungsapparat dienen die Knochen als Hebel und werden von der Skelett-Muskulatur bewegt. Das Muskel-Skelett (Bewegungsapparat) ist sozusagen der Hebel-Spezialist schlechthin.
12/30
Hebelklassen
Hebelklassen 1-3
Hebelzeichnungen I-III
Die Anordnung des Drehpunktes, der Kraft und Last bestimmt die Hebelklasse. Genauer gesagt bestimmt das Element in der Mitte des Hebelsystems die Hebelklasse.
13/30
Hebelklassen
Hebelklasse 1: Hebel mit Drehpunkt in Mitte
Zeichnung I des Archimedes: Wippe mit Dreieck in Mitte
Es handelt sich um einen zweiseitigen Hebel. Bei zweiseitigen Gelenken sind Kraft- und Lastarm jeweils auf der gegenüberliegenden Seite des Drehpunktes.
14/30
Hebelklassen
Bsp. Hebelklasse 1: Atlas-Kopf-Gelenk/ Wippe
Mit Kerze: nickender Kopf auf Wippe
Ein Beispiel im Körper für einen zweiseitigen Hebel und damit für einen Hebel, der Hebelklasse I ist das Atlas-Kopf-Gelenk. Dieses dient uns als Drehpunkt für das Nicken. Ein anderes Beispiel für einen zweiseitigen Hebel ist eine Wippe auf dem Spielplatz.
15/30
Hebelklassen
Hebelklasse 2: einseitiger Hebel mit Last in Mitte
Zeichnung II: Kasten in Mitte
Bei einseitigen Hebeln sind Last und Kraft auf einer Seite des Drehpunktes. Beispiele hierfür sind in unserem Körper Bizeps und Sprunggelenk.
16/30
Hebelklassen
Bsp. Hebelklasse 2: Schubkarre
Mit Schwanenflügel: Schubkarre
17/30
Hebelklassen
Bsp. Hebelklasse 2: Sprunggelenk
Fuß mit “Knast-Erde” in der Mitte
Beim Sprunggelenk sind die Zehen der Drehpunkt, die Last ist in der Mitte das Körpergewicht und die Kraft setzt hinten am Fersenknochen an.
18/30
Hebelklassen
Hebelklasse 3: einseitiger Hebel mit Kraftpunkt in Mitte
Zeichnung III: Gewicht am Ende
Wenn die Kraft (und nicht die Last) beim einseitigen Hebel in der Mitte ist, spricht man von der Hebelklasse 3. Es ist ein einseitiger Hebel, da Last- und Kraftarm auf einer Seite sind.
19/30
Hebelklassen
Bsp.: Hebelklasse 3: Ellbogen-Gelenk
Zeichnung des Ellbogen-Gelenks
Beispiel in unserem Körper für die Hebelklasse 3 ist in diesem Fall der Unterarm mit dem Drehpunkt im Ellbogengelenk. Die Kraft des Bizeps setzt direkt daneben an.
20/30
Hebelklassen
Bsp.: Hebelklasse 3: Schaufel mit Drehpunkt und Last
Mit drei Spitzen: Schaufel mit Dreh-Rolle und "Knast-Erde"
Ein praktisches Beispiel für Hebelklasse 3: eine Schaufel in der Hand (Kraft in der Mitte). Drehpunkt und Last sind entsprechend jeweils außen: Drehpunkt am einen Ende der Schaufel und Last auf der Schaufelfläche.
21/30
Drehmoment
Drehmoment: Formelzeichen 'M'
Dreht Zirkel: römischer Magister (M auf Helm)
Das Drehmoment beschreibt die Drehung mit einem bestimmten Radius r, die aus einer antreibenden Kraft F resultiert. Groß M ist auch das Formelzeichen des Drehmoments. Es gehört zu den skalaren Größen Energie und Arbeit.
22/30
Drehmoment
Formel: M = r × F
Magister (M) dreht Zirkel im Radius (r), Medaille (x), hebt Feuer-Falx (F)
Das Drehmoment M ist gleich dem Radius der Drehung klein r mal der Kraft groß F. Das Drehmoment ergibt sich aus dem Radius der Hebelbewegung und der Kraft.
23/30
Drehmoment
Einheit: Nm (Newtonmeter)
Neben Magister: Newtonperücke auf Meterstab
24/30
Drehmoment
Drehmoment und Kraftarm proportional
Newton-Meters muskulöse Arme im Proportional-Zeichen
Je länger der Kraftarm, desto größer das Drehmoment. Oder anders gesagt: Ein großer Hebelarm erzeugt mit wenig Kraft ein großes Drehmoment.
25/30
Hebelgesetz
Hebelgesetz – Gleichgewicht
Justitia mit Waage
Das Hebelgesetz wurde von Archimedes entdeckt. Es beschreibt die Wechselwirkung von Kraft und Last über den Hebel. Die beiden Kräfte des Hebelsystems sind dann im Gleichgewicht, wenn die Kraft, die der Kraftarm aufbringt, genau ausreicht, um die Last des Lastarmes zu halten.
26/30
Hebelgesetz
Kraft [N] × Kraftarm [m] = Last [N] × Lastarm [m]
Rechter muskulöser Arm, Rüstung mit '='-Zeichen, linker Arm mit Knast-Erde
Im Gleichgewicht eines Hebelsystems sind Kraft des Kraftarms und Last des Lastarms im Gleichgewicht.
27/30
Hebelgesetz
Last F in Newton
Schwerer Arm mit Rüstung und Knast-Erde: trägt Newton-Perücke
28/30
Hebelgesetz
Kraft F in Newton
Falx (sichelförmiges Schwert) mit Newtonperücke
F ist die Kraft in Newton, die nötig ist, um die Last zu halten.
29/30
Hebelgesetz
Lastarm und Kraftarm in Meter
Justitias Arme haben Meterabmessungen
30/30
schließen


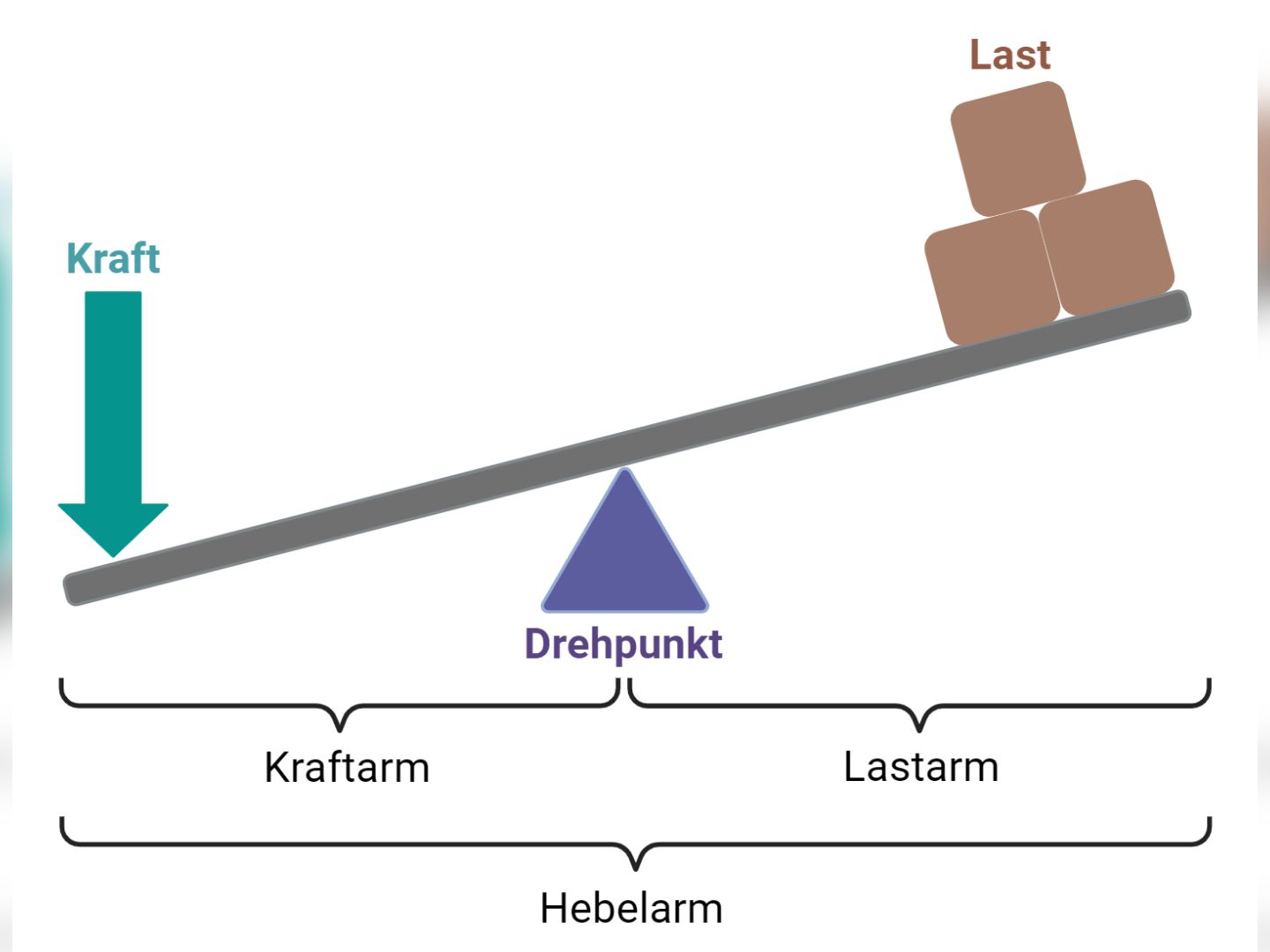
Der Hebelarm ist der gesamte starre Körper. Er kann weiter in Kraft- und Lastarm unterteilt werden.
Der Drehpunkt ist der Fixpunkt im System. In unserem Körper übernehmen meist die Gelenke diese Funktion.
Die Kraft wird durch die Muskeln vermittelt. Der Abstand von Muskelinsertionspunkt zum Gelenk ist also der Kraftarm.
Die Last ist z.B. das Körpergewicht oder ein Gewicht, dass wir tragen wollen. Der Lastarm ist der Abstand der Last zum Drehpunkt. Je länger der Lastarm, desto anstrengender ist die Bewegung.
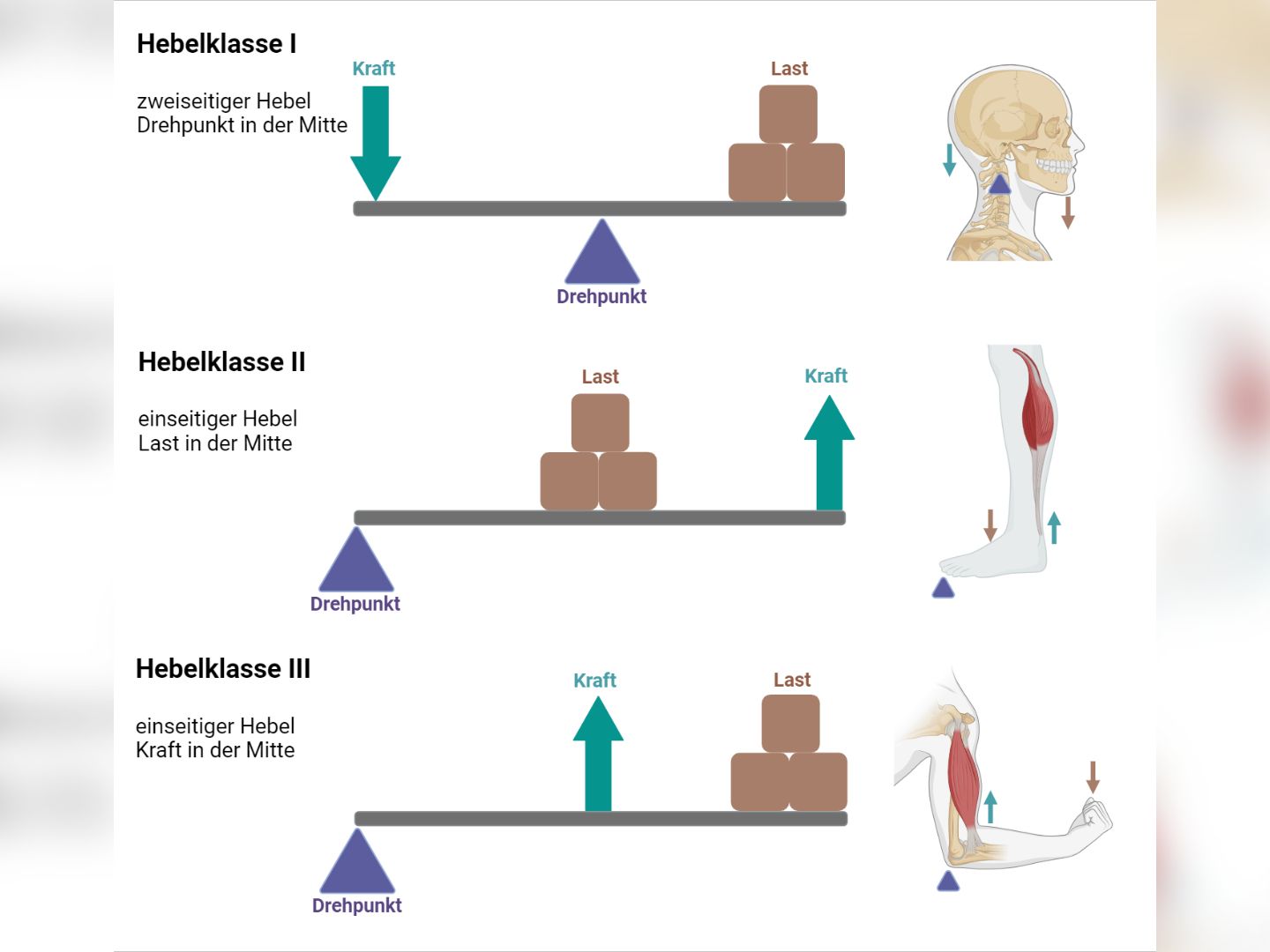
Bei Hebeln der Klasse I liegt der Drehpunkt in der Mitte. Kraft- und Lastarm liegen auf gegenüberliegenden Seiten. Beispiele sind eine Wippe oder das Atlas-Kopf-Gelenk.
Bei Hebeln der Klasse II liegen Last- und Kraftarm auf der gleichen Seite. Es handelt sich daher um einen einseitigen Hebel. Die Last liegt dabei in der Mitte und damit näher am Drehpunkt. Beispiele sind eine Schubkarre oder das Sprunggelenk (die Last ist hier das Körpergewicht, das z.B. beim Gehen angehoben werden soll)
Auch Hebel der Klasse III sind einseitige Hebel. Hier liegt aber die Kraft in der Mitte des Hebels und damit näher am Drehpunkt. Beispiele sind eine Schaufel und das Ellenbogengelenk (Drehpunkt ist hier der Ellenbogen, die Kraft wird durch den Bizeps vermittelt, der direkt daneben ansetzt).
fAsdnn34#SD6%4mgLS9(#k-mn
https://www.meditricks.de/wp-content/plugins/meditricks-mt-quiz/include/
n
48241
Was ist Ankizin?
Ankizin ist ein Projekt der AG Medizinische-Ausbildung bvmd e.V.
Es ist das größte non-profit, studentisch organisierte Anki-Projekt im deutschsprachigen Raum.
Ziel ist die Umsetzung des gesamten notwendigen Wissens für alle medizinischen Staatsexamina.
In freundlicher Kooperation bieten wir im Ankizin-Deck passgenau unsere Merkhilfen in den jeweiligen Anki-Karten an. Die so verknüpften Fragen kannst Du mit freundlicher Genehmigung der bvmd auch hier als Quiz ansehen.
Du findest alle Inhalte auch im Ankizin-Deck in Anki.
Es ist das größte non-profit, studentisch organisierte Anki-Projekt im deutschsprachigen Raum.
Ziel ist die Umsetzung des gesamten notwendigen Wissens für alle medizinischen Staatsexamina.
In freundlicher Kooperation bieten wir im Ankizin-Deck passgenau unsere Merkhilfen in den jeweiligen Anki-Karten an. Die so verknüpften Fragen kannst Du mit freundlicher Genehmigung der bvmd auch hier als Quiz ansehen.
Du findest alle Inhalte auch im Ankizin-Deck in Anki.
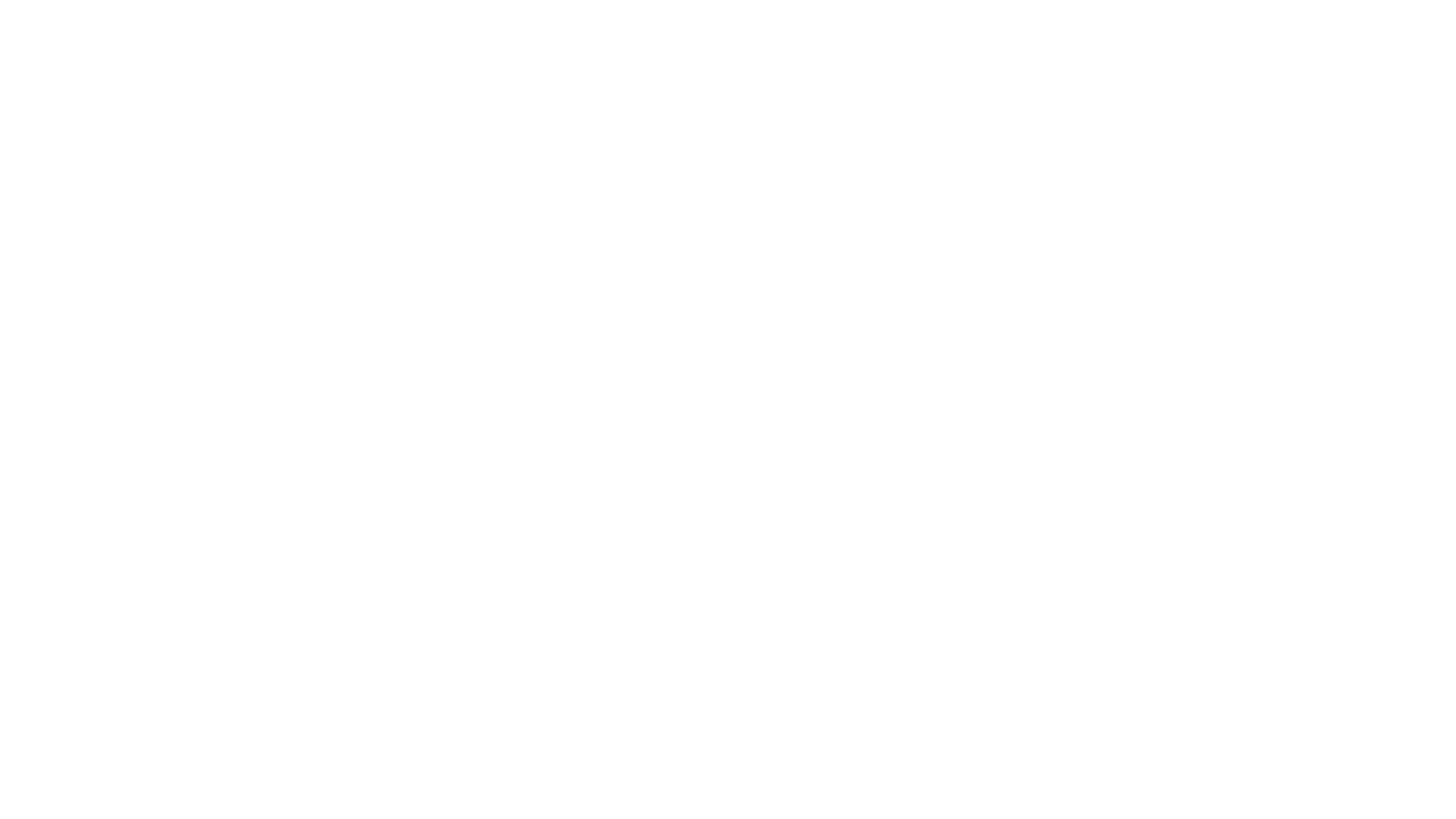
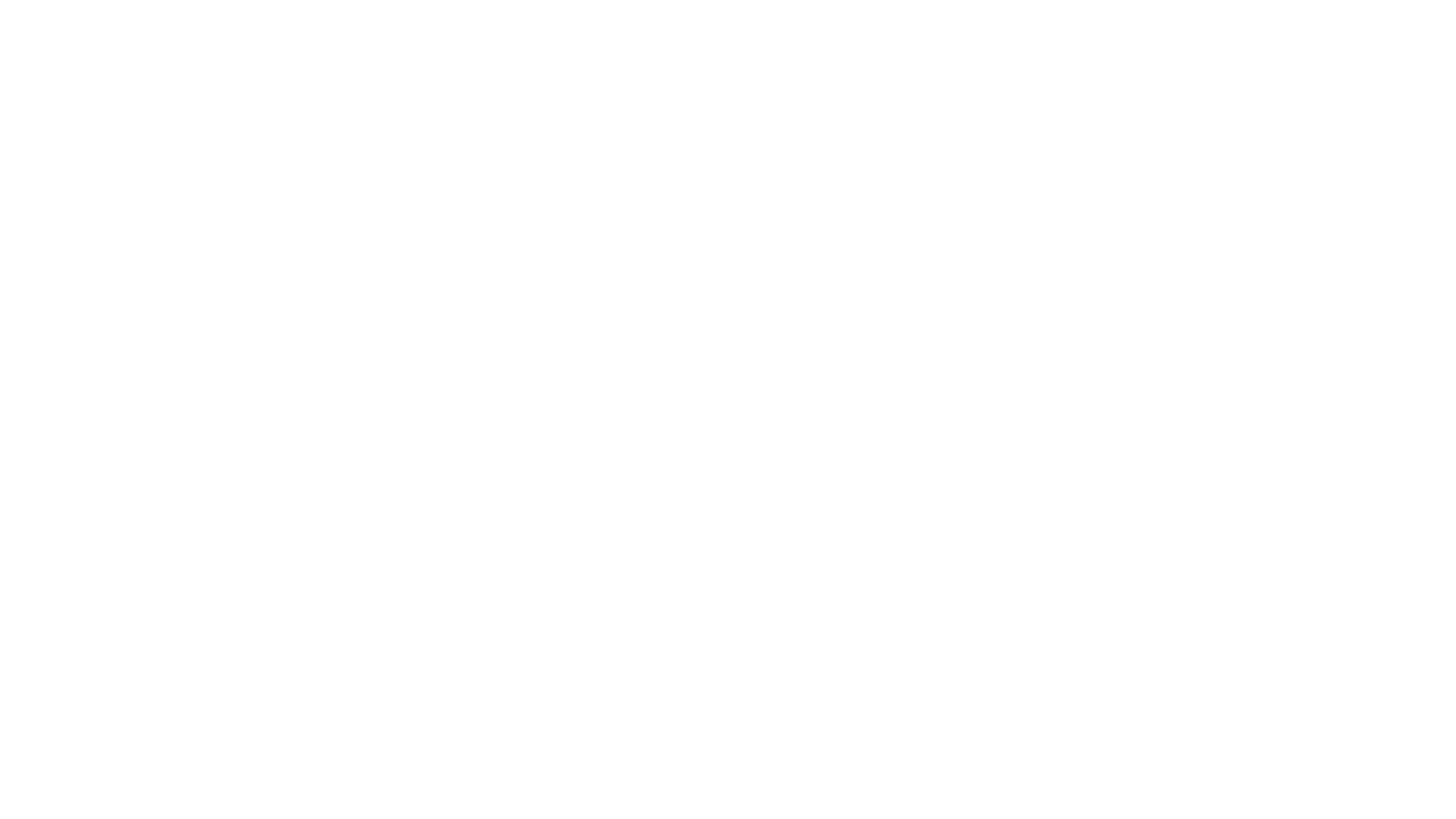
1
Grundlagen
Über Knochenhebel kann Welt bewegt werden
Hebel sind starre meist längliche Körper, mit deren Hilfe man Massen mit weniger Kraft halten oder bewegen kann. Dieses Verhältnis ist proportional: Je länger der Hebel, desto weniger Kraft braucht es. Der menschliche Bewegungsapparat benutzt Knochen als Hebel. Knochen sparen also u.a. unseren Muskeln Kraft, um Objekte zu bewegen.
alles
anzeigen
2
Grundlagen
Erde im Knast ('Last') mit Newton-Perücke
Grundlagen der Gewichtskraft: Alle Massen üben durch die Schwerkraft bedingt eine gewisse Kraft auf ihre Unterlage oder ihre Aufhängung aus. Diese Kraft wird Gewichtskraft (FG) genannt und in Newton angegeben. Jede Masse übt also eine Last mit der Gewichtskraft FG aus. Um diese Last zu bewegen, muss die Gewichtskraft überwunden werden.
alles
anzeigen
3
Grundlagen
Asse mit Kilo
Die Masse mit dem Formelzeichen m wird in Kilogramm angegeben. Die Masse ist nur ein Teil der Gewichtskraft, der jedoch überall im Universum gleich ist. Die Masse eines Autos ist auf der Erde und auf dem Mond gleich.
alles
anzeigen
4
Grundlagen
g-Apfel der Erde
Die Beschleunigung g (engl. gravitation) resultiert aus der Schwerkraft, welche die Masse anzieht.
alles
anzeigen
5
Grundlagen
G-Apfel auf Fahne in Form einer 9, Sanduhr, Kerze
Die Beschleunigung ist im Unterschied zur Masse abhängig vom Planeten und seiner Schwerkraft. Die Beschleunigung auf der Sonne ist zum Beispiel 28 Mal höher als auf der Erde.
alles
anzeigen
6
Grundlagen
Asse (m), Erde (stellt das Malzeichen dar), Gravitationsapfel (g)
Die Gewichtskraft ist die Masse (m) des Objektes mal der Beschleunigung. Während die Masse überall im Universum gleich ist, ändert sich die Beschleunigung je nach Schwerkraft des Planeten.
alles
anzeigen
7
Hebelaufbau
Humerus-Hebel
Der Hebelarm ist der gesamte starre Körper. Er kann weiter in Kraft- und Lastarm unterteilt werden, je nachdem wo am Hebel die Kraft und wo die Last in Bezug auf den Drehpunkt einwirkt.
alles
anzeigen
8
Hebelaufbau
Dreh-Rolle und Angel mit Gelenk
Ein Hebelsystem hat einen Dreh- bzw. Angelpunkt. In unserem Bewegungsapparat sind die Gelenke Dreh- und Angelpunkte der Hebel. Um diese Achse des Hebels herum werden Last und Kraft “aufeinander übertragen”.
alles
anzeigen
9
Hebelaufbau
Muskel [Meterstab-Markierung]: Teil zw. Archimedes und Drehpunkt
Auf dem Hebelarm ist dies der Abstand zwischen dem Drehpunkt (Gelenk, z.B. das Ellbogengelenk) und dem Punkt, wo die Muskelkraft angreift (Muskelinsertionspunkt, z.B. der Bizepssehne). Je größer der Kraftarm, desto mehr reduziert der Hebelarm die nötige Kraft. Einheit sind Meter.
alles
anzeigen
10
Hebelaufbau
Archimedes trägt für Kraftakt Newtonperücke
Die Kraft wird in unserem Bewegungsapparat von Muskeln aufgebracht und in Newton gemessen.
alles
anzeigen
11
Hebelaufbau
Knast um Ende des Knochens: darauf Erde
Der Lastarm ist die Seite des Hebels, auf der die Last liegt: der Abstand des Punktes, an dem die Last angreift, von der Drehachse. Je größer der Lastarm, desto größer ist die Kraft, die nötig ist, um die Last darauf zu bewegen. Last wird in Newton angegeben.
alles
anzeigen
12
Hebelklassen
Mit drei umnebelten Hebelbeispielen: Muskel-Skelett
Alle Komponenten eines Hebels werden als Hebelsystem bezeichnet. In unserem Bewegungsapparat dienen die Knochen als Hebel und werden von der Skelett-Muskulatur bewegt. Das Muskel-Skelett (Bewegungsapparat) ist sozusagen der Hebel-Spezialist schlechthin.
alles
anzeigen
13
Hebelklassen
Hebelzeichnungen I-III
Die Anordnung des Drehpunktes, der Kraft und Last bestimmt die Hebelklasse. Genauer gesagt bestimmt das Element in der Mitte des Hebelsystems die Hebelklasse.
alles
anzeigen
14
Hebelklassen
Zeichnung I des Archimedes: Wippe mit Dreieck in Mitte
Es handelt sich um einen zweiseitigen Hebel. Bei zweiseitigen Gelenken sind Kraft- und Lastarm jeweils auf der gegenüberliegenden Seite des Drehpunktes.
alles
anzeigen
15
Hebelklassen
Mit Kerze: nickender Kopf auf Wippe
Ein Beispiel im Körper für einen zweiseitigen Hebel und damit für einen Hebel, der Hebelklasse I ist das Atlas-Kopf-Gelenk. Dieses dient uns als Drehpunkt für das Nicken. Ein anderes Beispiel für einen zweiseitigen Hebel ist eine Wippe auf dem Spielplatz.
alles
anzeigen
16
Hebelklassen
Zeichnung II: Kasten in Mitte
Bei einseitigen Hebeln sind Last und Kraft auf einer Seite des Drehpunktes. Beispiele hierfür sind in unserem Körper Bizeps und Sprunggelenk.
alles
anzeigen
17
18
Hebelklassen
Fuß mit “Knast-Erde” in der Mitte
Beim Sprunggelenk sind die Zehen der Drehpunkt, die Last ist in der Mitte das Körpergewicht und die Kraft setzt hinten am Fersenknochen an.
alles
anzeigen
19
Hebelklassen
Zeichnung III: Gewicht am Ende
Wenn die Kraft (und nicht die Last) beim einseitigen Hebel in der Mitte ist, spricht man von der Hebelklasse 3. Es ist ein einseitiger Hebel, da Last- und Kraftarm auf einer Seite sind.
alles
anzeigen
20
Hebelklassen
Zeichnung des Ellbogen-Gelenks
Beispiel in unserem Körper für die Hebelklasse 3 ist in diesem Fall der Unterarm mit dem Drehpunkt im Ellbogengelenk. Die Kraft des Bizeps setzt direkt daneben an.
alles
anzeigen
21
Hebelklassen
Mit drei Spitzen: Schaufel mit Dreh-Rolle und "Knast-Erde"
Ein praktisches Beispiel für Hebelklasse 3: eine Schaufel in der Hand (Kraft in der Mitte). Drehpunkt und Last sind entsprechend jeweils außen: Drehpunkt am einen Ende der Schaufel und Last auf der Schaufelfläche.
alles
anzeigen
22
Drehmoment
Dreht Zirkel: römischer Magister (M auf Helm)
Das Drehmoment beschreibt die Drehung mit einem bestimmten Radius r, die aus einer antreibenden Kraft F resultiert. Groß M ist auch das Formelzeichen des Drehmoments. Es gehört zu den skalaren Größen Energie und Arbeit.
alles
anzeigen
23
Drehmoment
Magister (M) dreht Zirkel im Radius (r), Medaille (x), hebt Feuer-Falx (F)
Das Drehmoment M ist gleich dem Radius der Drehung klein r mal der Kraft groß F. Das Drehmoment ergibt sich aus dem Radius der Hebelbewegung und der Kraft.
alles
anzeigen
24
25
Drehmoment
Newton-Meters muskulöse Arme im Proportional-Zeichen
Je länger der Kraftarm, desto größer das Drehmoment. Oder anders gesagt: Ein großer Hebelarm erzeugt mit wenig Kraft ein großes Drehmoment.
alles
anzeigen
26
Hebelgesetz
Justitia mit Waage
Das Hebelgesetz wurde von Archimedes entdeckt. Es beschreibt die Wechselwirkung von Kraft und Last über den Hebel. Die beiden Kräfte des Hebelsystems sind dann im Gleichgewicht, wenn die Kraft, die der Kraftarm aufbringt, genau ausreicht, um die Last des Lastarmes zu halten.
alles
anzeigen
27
Hebelgesetz
Rechter muskulöser Arm, Rüstung mit '='-Zeichen, linker Arm mit Knast-Erde
Im Gleichgewicht eines Hebelsystems sind Kraft des Kraftarms und Last des Lastarms im Gleichgewicht.
alles
anzeigen
28
Hebelgesetz
Schwerer Arm mit Rüstung und Knast-Erde: trägt Newton-Perücke
29
Hebelgesetz
Falx (sichelförmiges Schwert) mit Newtonperücke
F ist die Kraft in Newton, die nötig ist, um die Last zu halten.
alles
anzeigen
30
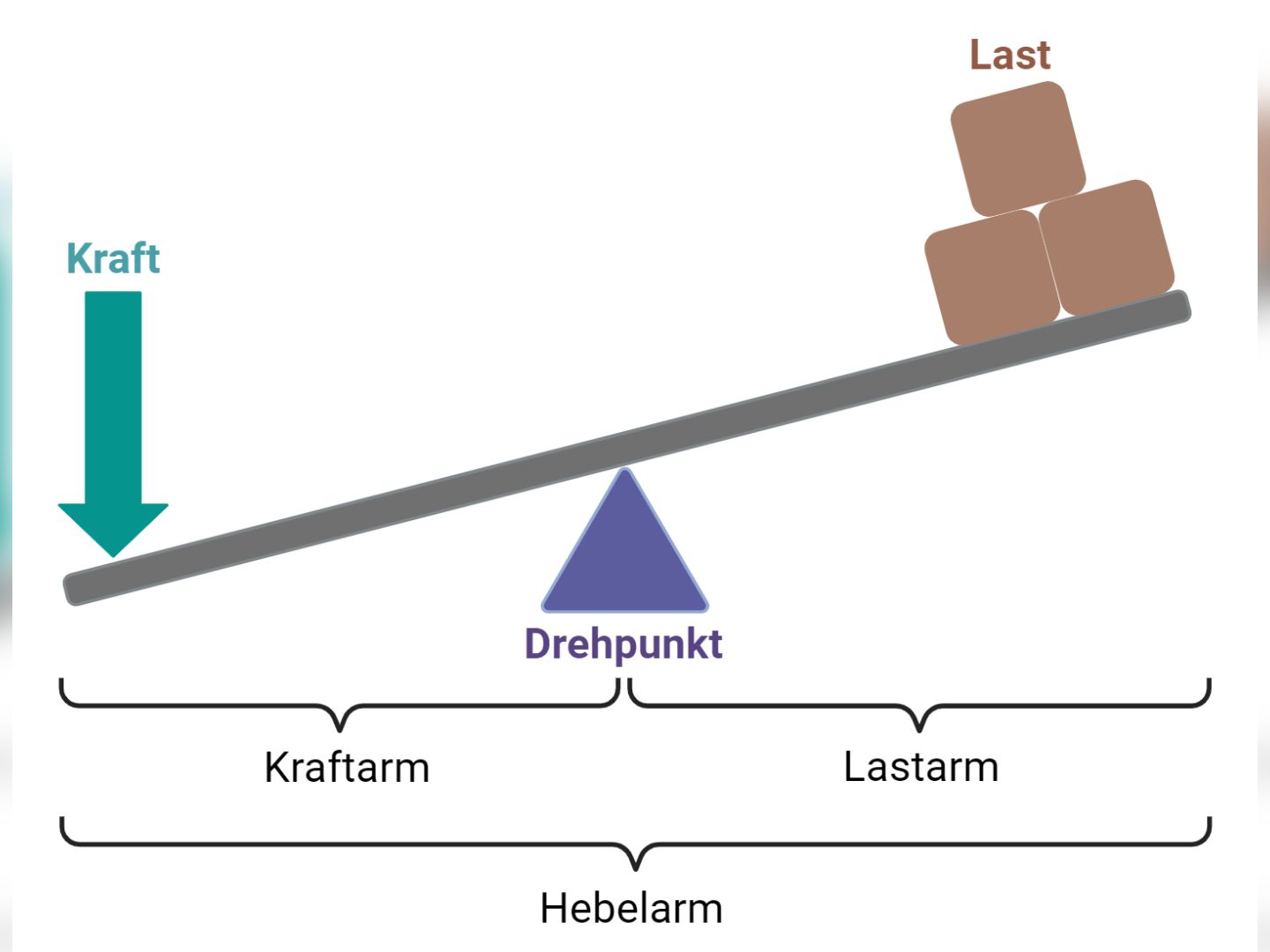
Hebelaufbau - Der Hebelarm ist der gesamte starre Körper. Er kann weiter in Kraft- und Lastarm unterteilt werden.
Der Drehpunkt ist der Fixpunkt im System. In unserem Körper übernehmen meist die Gelenke diese Funktion.
Die Kraft wird durch die Muskeln vermittelt. Der Abstand von Muskelinsertionspunkt zum Gelenk ist also der Kraftarm.
Die Last ist z.B. das Körpergewicht oder ein Gewicht, dass wir tragen wollen. Der Lastarm ist der Abstand der Last zum Drehpunkt. Je länger der Lastarm, desto anstrengender ist die Bewegung.
Der Drehpunkt ist der Fixpunkt im System. In unserem Körper übernehmen meist die Gelenke diese Funktion.
Die Kraft wird durch die Muskeln vermittelt. Der Abstand von Muskelinsertionspunkt zum Gelenk ist also der Kraftarm.
Die Last ist z.B. das Körpergewicht oder ein Gewicht, dass wir tragen wollen. Der Lastarm ist der Abstand der Last zum Drehpunkt. Je länger der Lastarm, desto anstrengender ist die Bewegung.
Meditricks Schaubild, erstellt mit BioRender.com
© Meditricks GmbH
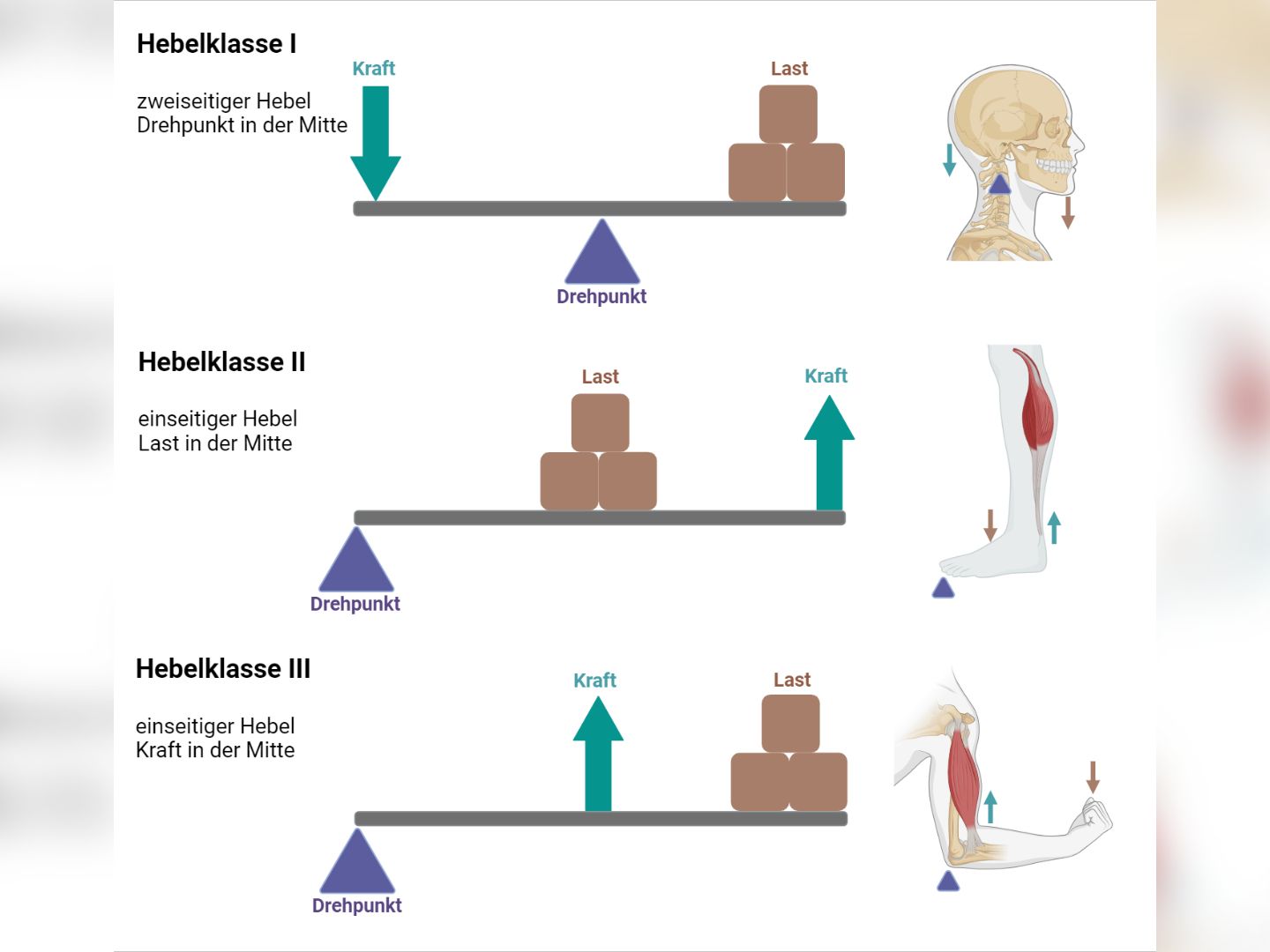
Hebelklassen - Bei Hebeln der Klasse I liegt der Drehpunkt in der Mitte. Kraft- und Lastarm liegen auf gegenüberliegenden Seiten. Beispiele sind eine Wippe oder das Atlas-Kopf-Gelenk.
Bei Hebeln der Klasse II liegen Last- und Kraftarm auf der gleichen Seite. Es handelt sich daher um einen einseitigen Hebel. Die Last liegt dabei in der Mitte und damit näher am Drehpunkt. Beispiele sind eine Schubkarre oder das Sprunggelenk (die Last ist hier das Körpergewicht, das z.B. beim Gehen angehoben werden soll)
Auch Hebel der Klasse III sind einseitige Hebel. Hier liegt aber die Kraft in der Mitte des Hebels und damit näher am Drehpunkt. Beispiele sind eine Schaufel und das Ellenbogengelenk (Drehpunkt ist hier der Ellenbogen, die Kraft wird durch den Bizeps vermittelt, der direkt daneben ansetzt).
Bei Hebeln der Klasse II liegen Last- und Kraftarm auf der gleichen Seite. Es handelt sich daher um einen einseitigen Hebel. Die Last liegt dabei in der Mitte und damit näher am Drehpunkt. Beispiele sind eine Schubkarre oder das Sprunggelenk (die Last ist hier das Körpergewicht, das z.B. beim Gehen angehoben werden soll)
Auch Hebel der Klasse III sind einseitige Hebel. Hier liegt aber die Kraft in der Mitte des Hebels und damit näher am Drehpunkt. Beispiele sind eine Schaufel und das Ellenbogengelenk (Drehpunkt ist hier der Ellenbogen, die Kraft wird durch den Bizeps vermittelt, der direkt daneben ansetzt).
Meditricks Schaubild, erstellt mit BioRender.com
© Meditricks GmbH
Meine Notizen
|
Menü Physiologie
Rückmeldung
Unsere Meditricks wurden mit viel Liebe ersonnen, illustriert und vertont. Gib uns gerne Lob, Kritik über die Feedback-Funktion unter den Meditricks oder schreib uns – siehe Kontakt.
Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.
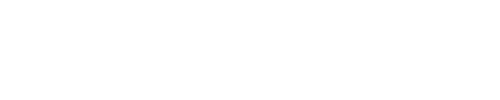



 Quint
Quint