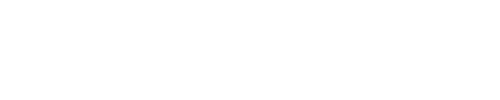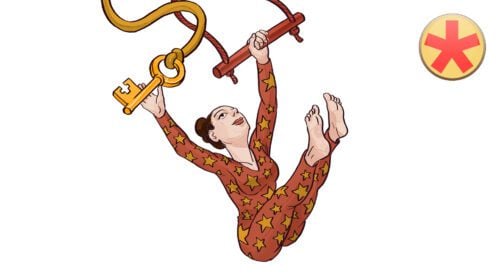Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.
Hier kannst Du einen Zugang erwerben.
Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.
Hast Du bereits einen Zugang?
Melde Dich bitte unter 'Profil' an.
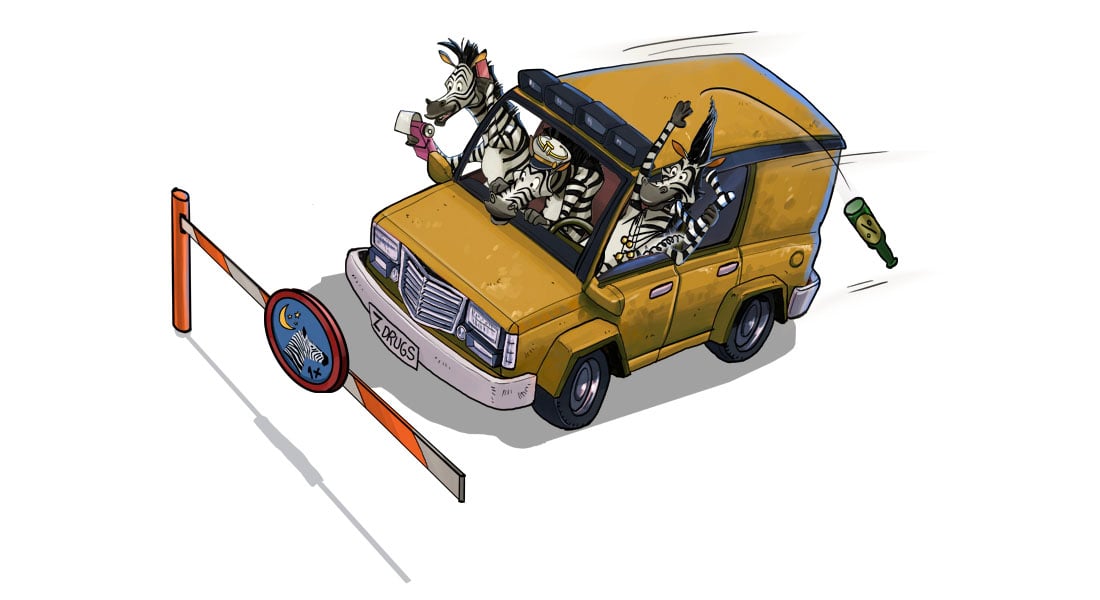
Hier eine Vorschau,
wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Morbus Perthes
- Aseptische Knochennekrose
- Erkrankungsgipfel: 4.- 8. Lebensjahr
- Leitsymptom: Schonhinken
- Hüft-/ Oberschenkelschmerzen
- Ausstrahlende Schmerzen ins Knie
- Bewegungseinschränkung im Hüftgelenk (Abduktion und Innenrotation vermindert)
- Diagnostik: Röntgenaufnahme nach Lauenstein
- Therapie: Überdachung des Femurkopfes durch die Gelenkpfanne verbessern (Containment)
- Operativ: Osteotomie (v.a. Intertrochantäre Varisierungsosteotomie)
- DD Coxitis fugax , Epiphysiolysis capitis femoris
- Umso jünger bei Diagnosestellung desto günstiger die Prognose
Basiswissen
-
Allgemeines
Morbus Perthes
Peer aus Thessaloniki
Der Morbus Perthes ist eine Knochenerkrankung des Kindesalters.
-
Allgemeines
Aseptische Knochennekrose des Femurkopfes
Verlorene Seppel-Puppe
Aseptisch = nicht-entzündlich.
-
Epidemiologie
Ca. 5. Lj.: Häufigkeitsgipfel
5 Berggipfel
Der Morbus Perthes tritt am häufigsten bei Kindern zwischen dem 4. - 8. Lebensjahr auf.
-
Epidemiologie
Männer häufiger betroffen 4:1
4 männliche, 1 weibliches Gipfelkreuz
-
Klassifikation > Waldenström
Einteilung nach Waldenström
Über dem Wald strömender Regen
Die Einteilung nach Waldenström richtet sich nach den Röntgenbefunden.
...
Expertenwissen
-
Allgemeines
Selten beidseits
Beide Beine verloren
In 15 % der Fälle ist der Befall beidseitig, meist zeitversetzt.
-
Klassifikation > Waldenström
Initialstadium: Verbreiterung des Gelenkspalts / Gelenkerguss
1. Tür-Fünftel: abgespreizte Tür / Pfütze
Das Initialstadium ist gekennzeichnet durch eine Verbreiterung des Gelenkspalts zwischen Femurkopf und Acetabulum. Parallel dazu liegt ein Gelenkerguss vor.
-
Klassifikation > Waldenström
Kondensationsstadium: Verdichtung des Knochenkerns
2. Tür-Fünftel: eingebeulter Kern
...
Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,
werde Teil der Lernrevolution.
Neu
Die 10 neuesten Meditricks:
Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.