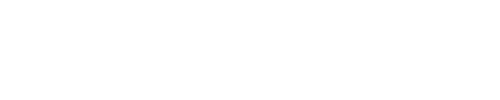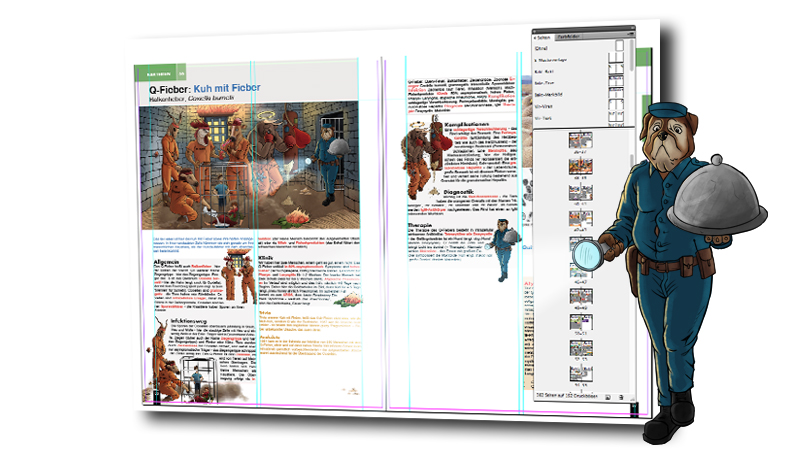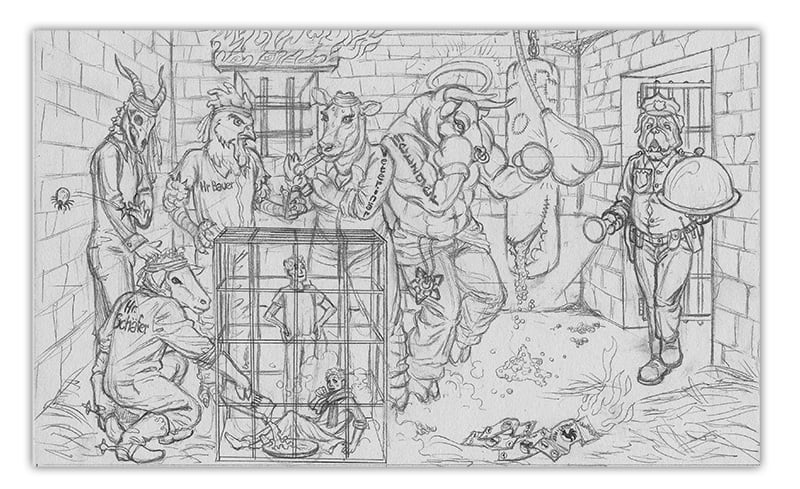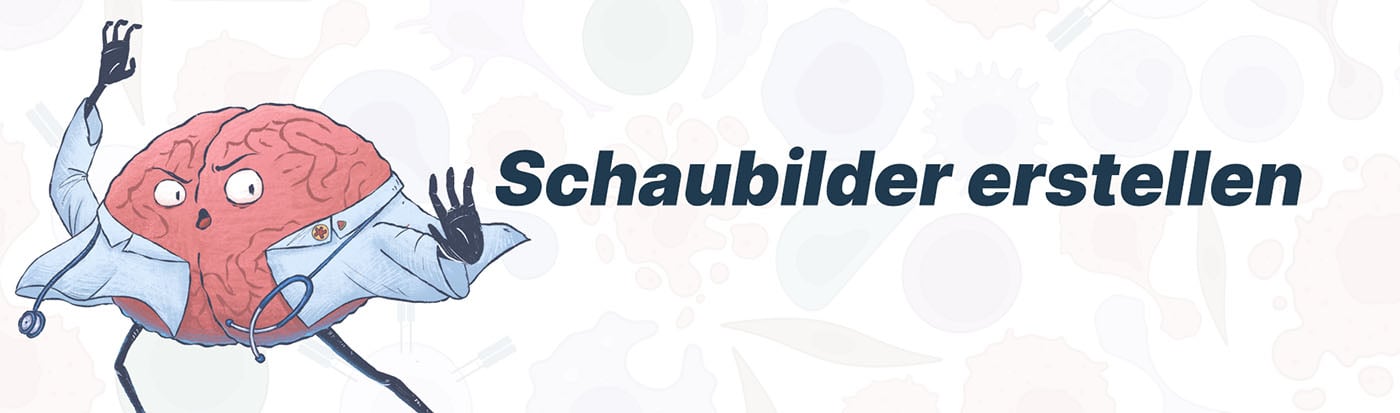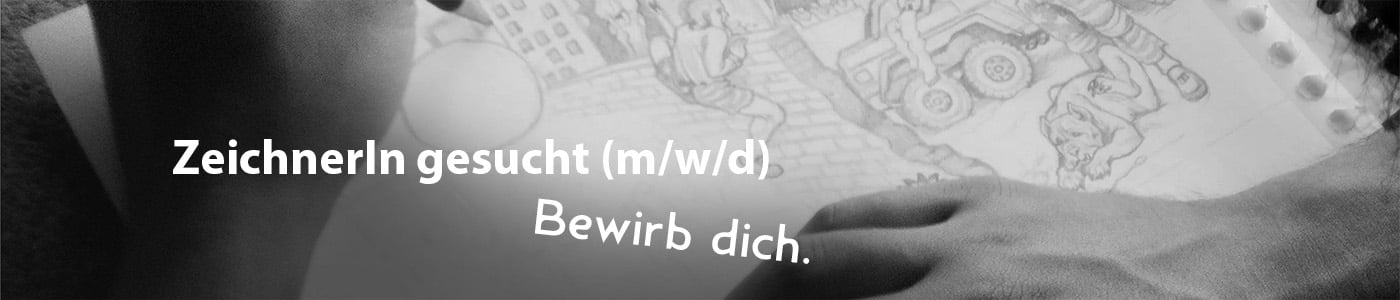Beteilige Dich als/an
Neu ab Juli 2025:
Recherche-Redakteur*in für Meditricks
Hilf Medizinstudierenden, das Wesentliche zu verstehen & zu merken!
Wir suchen zwei neue studentische Redakteur*innen für unser Team. Deine Aufgabe: Kleine bis mittlere Themen recherchieren. Welche Fakten sind wirklich wichtig? Was fällt Studierenden schwer zu merken? Diese Inhalte bilden die Grundlage für unsere Merkbilder (die Bild-Erstellung übernimmt unser erfahrenes Team).
Warum?
Mit deiner Arbeit hilfst du tausenden Medizinstudierenden, komplexe Inhalte schneller zu verstehen und sicher fürs Examen abzuspeichern.
Wir suchen:
- Du bist idealerweise am Anfang oder in der Mitte deines Medizinstudiums, damit du die Lernschwierigkeiten der Studierenden aus eigener Erfahrung kennst und längerfristig bei uns mitarbeiten kannst.
- Du arbeitest selbstständig
- Du hast einen hohen Anspruch an deine Arbeit
- Minijob-Basis: 20–30 Stunden/Monat
- Vergütung: 15 €/h netto
- Start: Ab sofort
- Ort & Zeit: Flexibel (wann & wo du willst)
Bewerbungsablauf
Wir wollen keine Zeugnisse. Wir wollen sehen, wie Du die Dinge angehst:
- Lies die Anweisungen und das Beispiel.
- Erstelle eine Recherche zum Thema „Silikose“.
- Teile uns den Link zu deinem Google-Dokument mit (bitte Freigabe nicht vergessen!).
Deine Aufgabe:
- Recherchiere die wichtigsten Fakten zur Silikose
- Du entscheidest, wie viele Fakten zum Thema in das Merkbild kommen sollen
- Erstelle deine Recherche als Google-Dokument und teile uns den Link (bitte freigeben)
- Orientiere dich an unserem Beispiel (BPLS, siehe unten), was das Format angeht: Du darfst (und sollst) selbst entscheiden, wie du Struktur und Erklärungen am besten aufbereitest – wir wollen sehen, wie du eigenständig denkst.
- Entscheide, welche Fakten stichpunktartig aufgeführt werden und welche eine zusätzliche Beschreibung brauchen, um verständlich zu sein
- Verfasse eine Inhaltliche Einleitung (Abstract) und optional nutze die “erweiterte Einleitung”, um wichtige Konzepte oder Grundverständnis für das Thema zu ergänzen – somit wird verständlich erklärt, aber in das Merkbild kommt nur, was schwer und wichtig zu merken ist.
- Zusammengefasst:
- Fakt: Was gemerkt werden soll (bspw. “[Silikose] Gehört zu Pneumokoniosen”
- Beschreibung: Ausführung, falls nötig (Ergänzende Ausführung zum Fakt, um Verständnis zu fördern, Kontext zu geben)
- Inhaltliche Einleitung: Abstract – keine Zusammenfassung des Themas sondern das Bigger-Picture: Warum ist das wichtig? Was bedeutet das Thema?
- Erweiterte Einleitung: Wichtige Konzepte oder Grundlagen zum Verständnis des Themas, erklärend ausgeführt, die aber im Merkbild selbst nicht so ausführlich behandelt werden.
- Schreib am Ende eine kurze Selbstreflexion: Was war die größte Herausforderung bei dieser Aufgabe?
Bewertungskriterien
- Inhaltliche Richtigkeit
- Fokus auf Kernaussagen für das Merkbild
- Klarheit & Struktur
- Didaktische Aufbereitung: Erläuterung des Themas in der inhaltlichen Einleitung und Erklärung wichtiger Konzept in der erweiterten Einleitung
- Eigenständige Ergänzungen zur besseren Verständlichkeit
Abgabe
- Jederzeit bis spätestens Ende August
- Link zu deinem Google Dokument (bitte freigeben) an paul@meditricks.de
Fragen
Fragen sind ausdrücklich willkommen – zeig uns, dass du mitdenkst! Schreib an paul@meditricks.de
Beispiel-Recherche zur Orientierung
Hier die Recherche zum Benignen paroxysmalem Lagerungsschwindel, BPLS inklusive Einleitung und erweiterter Einleitung. Die bereitgestellten Beispielinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Bitte verwende sie ausschließlich für deine Bewerbung.
Beispiel: Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel, BPLS
Inhaltliche Einleitung
Der paroxysmale benigne Lagerungsschwindel (BPLS) ist die häufigste Ursache für peripheren Schwindel. Er entsteht durch abgelöste Otokonien bzw. Otolithen-Fragmente („Ohrsteinchen“), die in die Bogengänge des Gleichgewichtsorgans gelangen und dort bei Kopfbewegungen zu fehlerhaften Reizen führen. Charakteristisch sind plötzliche, kurz andauernde Schwindelattacken, ausgelöst durch bestimmte Kopfbewegungen oder Lagerungswechsel, oft verbunden mit Übelkeit. Das wichtigste diagnostische Werkzeug ist der Dix-Hallpike-Test. Therapeutisch helfen Lagerungsmanöver (z. B. Epley-Manöver), die die Otokonien wieder in den Vorhof (mit Utrikulus und Sacculus) zurückführen. In unserem Merkbild konzentrieren wir uns auf die wichtigsten klinischen Merkmale, die Lagerungsdiagnostik sowie die Prinzipien der Behandlung.
Erweiterte Einleitung
Das Vestibularorgan (Gleichgewichtsorgan) im Innenohr besteht aus drei Bogengängen (anterior, horizontal, posterior – Wahrnehmung der rotatorischen Beschleunigung) und zwei Macula-Organen (Utrikulus und Sakkulus – Wahrnehmung der linearen Beschleunigung).
Beim BPLS lösen sich Otokonien (kleine Kalziumkarbonatkristalle) meist aus dem Utrikulus und gelangen in die Bogengänge. Die Otokonien sitzen auf der gallertigen otolithären Membran, die über den Haarzellen der Maculaorgane (Utrikulus und Sakkulus) liegen. Die Gesamtheit aus Otholitenmembran und eingebetteten Otokonien bezeichnet man als Otolith.
–Warum der posteriore Bogengang am häufigsten betroffen ist (~85 %):
In aufrechter Kopfhaltung liegt der posteriore Bogengang anatomisch am tiefsten. Gelöste Otokonien sinken durch die Schwerkraft bevorzugt in diesen Kanal und sammeln sich dort.
–Canalolithiasis vs. Cupulolithiasis
Canalolithiasis (häufiger): Die Otokonien schwimmen frei in der Endolymphe des Bogengangs und führen bei Kopfbewegungen zu einer transienten, mechanischen Reizung der Cupula.
Cupulolithiasis (seltener): Die Otokonien haften an der Cupula selbst und machen diese träger, was oft einen längeren und persistenteren Nystagmus auslöst.
–Pathophysiologie
Diese mechanischen Reize führen zur inadäquaten Auslenkung der Haarzellen und damit zur Wahrnehmung einer falschen Drehbewegung — der klassische Drehschwindel entsteht.
Die Pathophysiologie erklärt, warum der Schwindel meist nach Sekunden abklingt (Otokonien „sinken“ ab) und warum gezielte Lagerungsmanöver helfen können (Ausräumen der Otolithen zurück in den Utrikulus).
–Epidemiologie
Typischerweise betrifft der BPLS vor allem Menschen im Alter von 50–60 Jahren, da es in diesem Lebensabschnitt vermehrt zu degenerativen Veränderungen des otolithären Membransystems kommt.
–Diagnostik
Der BPLS verursacht keinen Spontannystagmus, da der Reiz nur bei spezifischen Lageänderungen ausgelöst wird und nicht dauerhaft anliegt. Ebenso fehlen ein Blickrichtungsnystagmus und Störungen der Blickfolge oder Willkürsakkaden, weil diese zentralen oder dauerhaften vestibulären Läsionen vorbehalten sind. Beim BPLS ist das periphere Vestibularorgan in Ruhe unauffällig. Erst durch gezielte Lagerungsproben (z. B. Dix-Hallpike-Manöver) werden die frei schwimmenden Otokonien mobilisiert und provozieren einen Lagerungsnystagmus, dessen Richtung und Form eine eindeutige Zuordnung des betroffenen Bogengangs erlauben (z. B. Upbeat-torsional-Nystagmus beim posterioren Bogengang). So kann klinisch meist ohne zusätzliche Bildgebung eine sichere Diagnose gestellt und gleichzeitig der betroffene Kanal identifiziert werden. (Bildgebung kann bei unklarer Klinik trotzdem indiziert sein.) Ist der betroffene Kanal identifiziert, hilft dies bei der Auswahl des therapeutischen Manövers: Ziel ist es, die Otokonien aus dem jeweiligen Bogengang zu “schütteln”.
––Dix-Hallpike-Manöver (posteriore Bogengänge)
Das Dix-Hallpike-Manöver ist das Standardverfahren zur Diagnose eines BPLS des posterioren Bogengangs. Dabei sitzt die Patientin oder der Patient zunächst aufrecht und dreht den Kopf um etwa 45° zur betroffenen (zu testenden) Seite. In dieser Position wird der Kopf zusätzlich um circa 30° nach hinten überstreckt, sodass der posteriore Bogengang in eine vertikale Position gebracht wird. Anschließend wird die Person zügig und kontrolliert in Rückenlage gebracht, wobei der Kopf über die Tischkante hinaus geneigt bleibt. Durch diese plötzliche Bewegung geraten die frei schwimmenden Otokonien in Bewegung und reizen die Haarzellen im posterioren Bogengang. Typischerweise zeigt sich dabei ein Upbeat-torsional-Nystagmus, also ein zur Stirn hochschlagender Nystagmus mit rotatorischer Komponente in Richtung des betroffenen Ohrs.
––weitere Lagerungsmanöver
Beim horizontalen Bogengang dient das Supine-Roll-Manöver zur Diagnose, typischerweise mit horizontalem Nystagmus, gefolgt vom sogenannten Barbecue-Manöver (Lempert-Manöver) zur Therapie, bei dem der Kopf in mehreren Schritten gedreht wird, um die Otokonien herauszutransportieren. Der selten betroffene anteriore Bogengang wird durch starkes Kopf-Hängen getestet und mit modifizierten Lagerungsmanövern behandelt.
–Differenzialdiagnosen
Weitere Differenzialdiagnosen (z. B. zentraler Schwindel und vestibuläre Migräne) sind immer zu bedenken, insbesondere bei atypischen Verläufen oder zusätzlichen neurologischen Symptomen.
Aber nun zum Merkbild mit den wichtigsten Fakten!
Merkbild
1 - Grundlagen
(1) Fakt: Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel (BPLS)
Beschreibung: Im Englischen: benign paroxysmal positional vertigo, BPPV.
(2) Fakt: Häufigste Ursache peripher-vestibulären Schwindels
Beschreibung: Rund 20 % aller Schwindelursachen entfallen auf den BPLS.
(3) Fakt: Meist 50.–60. Lebensjahr
Beschreibung:
(4) Fakt: Spontane Besserung möglich
Beschreibung: Auch ohne Therapie kann der Schwindel nach Tagen bis Wochen verschwinden, durch natürliche Resorption oder Rückwanderung der Otokonien (auch als Otolithen-Fragmente bezeichnet) in den Utrikulus.
2 - Pathophysiologie
(5) Fakt: Otokonien („Ohrsteinchen“) im Bogengang
Beschreibung: Canalolithiasis: Meist aus dem Utrikulus gelöst (selten traumatisch), gelangen die Otokonien in den hinteren (am häufigsten), horizontalen oder anterioren Bogengang. Otolithen = Otokonien + gallertige otolithäre Membran.
(6) Fakt: Posteriorer Bogengang am häufigsten betroffen
Beschreibung: In aufrechter Kopfhaltung liegt der posteriore Bogengang am tiefsten. Daher sinken gelöste Otokonien durch Schwerkraft bevorzugt hinein.
(7) Fakt: Abnorme Reizung der Haarzellen → Schwindel
Beschreibung: Die Otokonien bewegen sich bei Kopfbewegung, reizen Cupula und Haarzellen fälschlich, dies führt zu fehlerhaften Signalen ans Gehirn, die als Drehschwindel wahrgenommen werden.
3 - Klinik
(8) Fakt: Drehschwindelattacken, Sekunden bis max. 1 Minute
Beschreibung: Typisch sind attackenartige, drehende Schwindelgefühle nach Lagerungswechsel, oft verbunden mit Übelkeit. Es kommt zur spontanen Abnahme der Symptome bei Ruhigstellung des Kopfes.
(9) Fakt: Häufig Übelkeit/Erbrechen während Attacken
Beschreibung:
(10) Fakt: Auslöser: rasche Lagewechsel (Hinlegen, Kopfdrehung/-reklination)
Beschreibung: Meist morgens beim Aufstehen oder nächtliches Umdrehen im Bett.
(11) Fakt: Keine kochleären Symptome (Hörminderung, Tinnitus)
Beschreibung: → Abgrenzung zu Menière-Krankheit.
4 - Diagnostik
(12) Fakt: Dix-Hallpike-Manöver bei V.a. posterioren Bogengang
Beschreibung: Drehschwindel und Upbeat-torsional-Nystagmus bei positivem Test sind typisch.
(13) Fakt: Supine-Roll-Manöver bei V.a. horizontalen Bogengang
Beschreibung: Es zeigt sich ein horizontaler Nystagmus.
5 - Therapie
(14) Fakt: Epley-Manöver (posteriorer Bogengang)
Beschreibung: Schrittweise Lagerungsmanöver zur Rückführung der Otolithen in den Utrikulus.
(15) Fakt: Barbecue-Roll-Manöver (horizontaler Bogengang)
Beschreibung:
(16) Fakt: Wiederholung der Manöver bei Rezidiv
Beschreibung: BPLS rezidiviert bei ca. 30–50 % der Patienten innerhalb von Monaten bis Jahren.