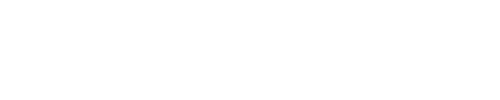Diese Inhalte sind den Nutzenden von Meditricks vorbehalten.
Hier kannst Du einen Zugang erwerben.
Du bist neu hier? Informiere Dich über Meditricks.
Hast Du bereits einen Zugang?
Melde Dich bitte unter 'Profil' an.
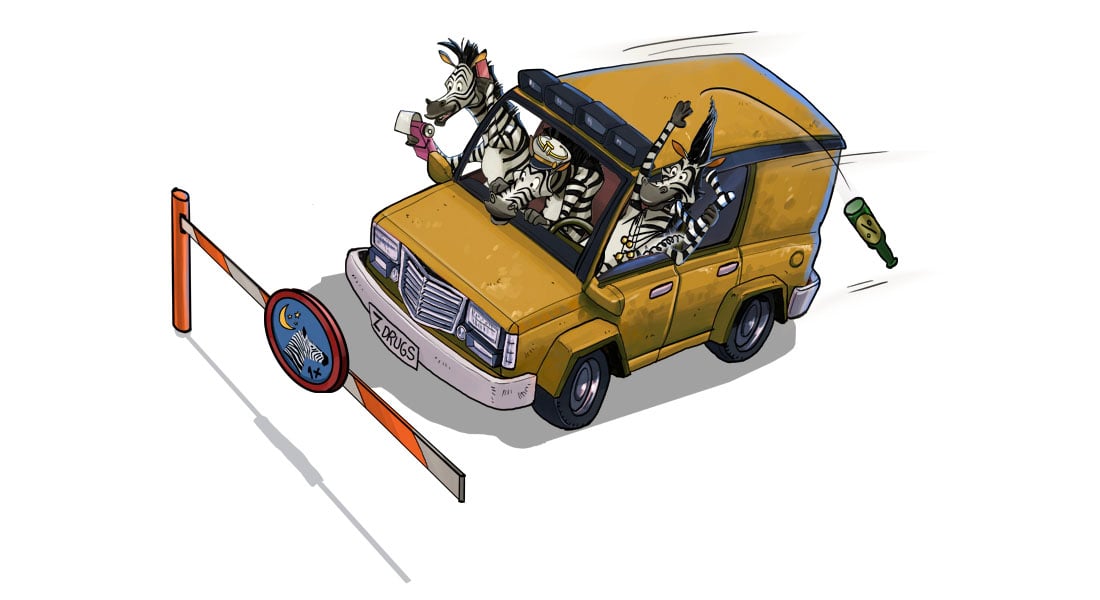
Hier eine Vorschau,
wie wir dieses Thema behandeln und wie unsere Eselsbrücken aussehen:

Insulin: Klinische Aspekte und Interaktion
Basiswissen
-
Klinische Aspekte
Diabetes-Patienten sollten immer Trauben- oder Würfelzucker mit sich führen
Insulines Tochter mit Vorrat an Trauben- und Zuckerwürfelchen
Es besteht das Risiko einer Hypoglykämie bei Überdosierung von Insulin, bei Anstrengung sowie in Stresszuständen.
-
Klinische Aspekte
Insulin ist nicht plazentagängig: keine Einschränkung in Schwangerschaft und Stillzeit
Insulines Tochter hat ein Baby dabei
-
Klinische Aspekte
Größere Hautdepots verlangsamen die Resorption
Schaufeldepot: Stau unter den kleinen Insulanern
V.a. bei einer bereits fortgeschrittenen Insulinresistenz wird hierdurch der Therapieeffekt zusätzlich minimiert, sodass die benötigte Insulindosis entsprechend höher ist.
-
Klinische Aspekte
Die Resorption ist stark abhängig von: Injektionsort, Injektionstechnik, Injektionstiefe → Patientenschulung!
Insulaner diskutieren über besten Ort, beste Grabetechnik, beste Tiefe → weisen andere Bewohner ein
-
Probleme der Insulintherapie > Dawn-Phänomen
(1) Dawn-Phänomen: frühmorgendliche Hyperglykämien (v.a. Typ-I-Diabetes)
Sonnenaufgang: Pyramide aus Zuckerwürfelchen (junge Auto-Bärin)
...
Expertenwissen
-
Klinische Aspekte
Adäquater Magnesiumspiegel verbessert Insulinwirkung
Magnet zieht Insulaner an
Magnesium moduliert die von Insulin ausgelösten, intrazellulären Signalkaskaden (Magnet zieht Insulaner an). Insulin fördert allerdings die Aufnahme von Magnesium in die Zellen, weshalb es unter Insulintherapie oft zu Hypomagnesiämie kommt. Der Körper kompensiert diese durch Resorption von Magnesium aus den Knochen.
-
Einfluss von Medikamenten > Erhöhter Insulinbedarf
Östrogene (Kontrazeptiva) → ↑ Wachstumshormone → ↑ Anabolismus und ↓Lipolyse
Auf dem Berg: Ess-Drache (engl. (Ess-)dragon = Estrogen) mit Wachs-Tuch-Mohn und Ananas
So kommt es zu einer vermehrten Insulinresistenz.
-
Einfluss von Medikamenten > Erhöhter Insulinbedarf
Thiazide & Schleifendiuretika → Kalium- & Magnesiumdepletion → ↓ Effektivität ß-Zellen
Auf dem Berg: Insuline zieht ein Tier mit gelber Schleife im Haar → dieses frisst den Bananen- und Nussvorrat
Ggf. ist dann eine Kaliumsubstitution notwendig.
...
Beginne das Lernen mit unseren Eselsbrücken,
werde Teil der Lernrevolution.
Neu
Die 10 neuesten Meditricks:
Gereift unter der Sonne Freiburgs. mit viel Liebe zum Detail ersonnen, illustriert und vertont. Wir übernehmen keine Haftung für nicht mehr löschbare Erinnerungen.